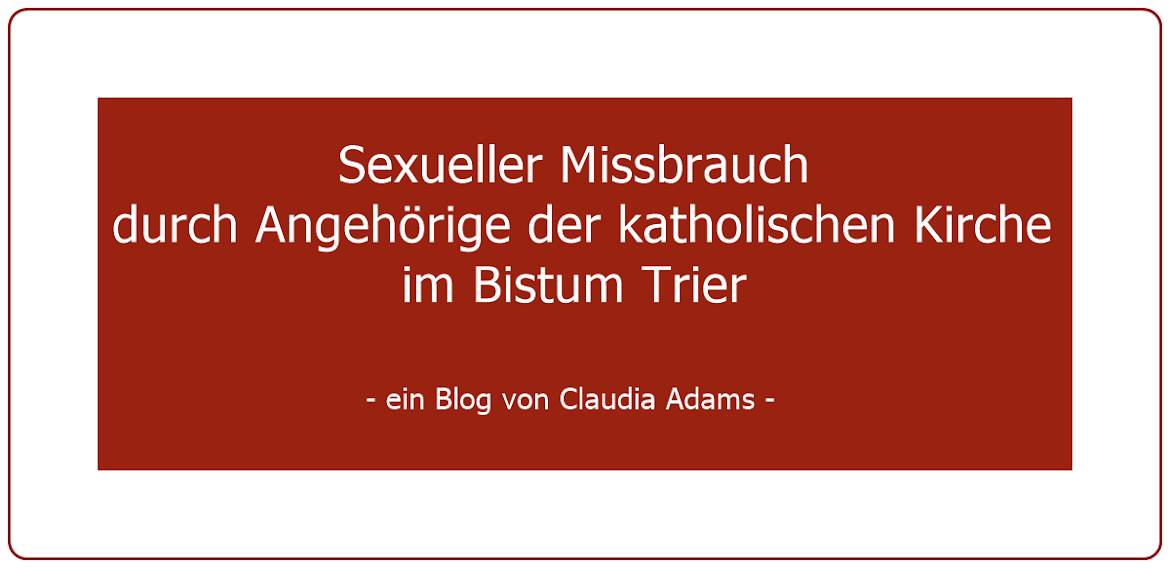"Heute haben Prof. Dr. Lutz Raphael und Dr. Lena Haase einen weiteren Zwischenbericht vorgelegt, in dem sie den Umgang mit sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bistum Trier in der Amtszeit meines Vorgängers, Bischof Dr. Reinhard Marx, und in meiner eigenen Amtszeit bis 2021 in den Blick nehmen.
Respekt und Bitte um Verzeihung
Dass es mich sehr bewegt hat, den 139 Seiten umfassenden Text zu lesen, können Sie sicher nachvollziehen. Ich blicke mit großem Respekt auf den Bericht – zuallererst mit Respekt für die Betroffenen: für ihre Bereitschaft, die Verbrechen, die Priester und Angestellte des Bistums Trier an ihnen begangen haben, anzuzeigen und darüber zu sprechen, oft in der Sorge, ob ihnen geglaubt wird oder ihre Anzeige ohne Konsequenzen bleibt. Zugleich bin ich voller Respekt für ihre Beharrlichkeit, nicht nachzulassen in ihrer Forderung, dass der Umgang mit diesen Verbrechen im Bistum Trier aufgearbeitet werden muss.
Neben dem Respekt, den ich empfinde, überkommt mich allerdings auch Traurigkeit über das Geschehene: an erster Stelle über das Verbrechen des Missbrauchs mit all der Belastung, die das für die Betroffenen gebracht hat. Ich empfinde Traurigkeit über das, was von Verantwortlichen versäumt worden ist, aber auch über die Grenzen, an die ich persönlich und diejenigen, die seit 2009 mit mir Verantwortung getragen haben, gestoßen sind. Wir müssen uns sagen lassen, dass die nötige Perspektive der Betroffenenorientierung bis in die jüngste Zeit nicht immer konsequent eingehalten worden ist.
Die Studie führt detailliert aus, wie ich gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit meinem Amtsantritt im Jahr 2009 mit den Fällen sexualisierter Gewalt umgegangen bin. Dabei ist der Lernprozess erkennbar. Aber natürlich benennt die Studie auch die Fehler, die wir gemacht haben. Der Bericht zeigt einmal mehr das große Leid der Betroffenen auf. Er zeigt die Folgen des Missbrauchs wie auch die Folgen des teils nicht angemessenen Umgangs damit von Seiten der Verantwortlichen im Bistum.
Sie haben den Satz in den letzten Jahren oft gehört und er mag für manche abgenutzt klingen, aber für mich stimmt er nach wie vor: Die Schilderungen dieses Berichts zu lesen, schmerzt mich. Mindestens 24 Menschen, so sagt es die Studie, sind in meiner Amtszeit Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Das ist schrecklich. Nicht alle diese Betroffenen sind uns Verantwortlichen im Bistum bekannt, weil sie bisher den Weg zu uns nicht gefunden haben. Ich bitte daher darum, wenn es ihnen möglich ist, sich auch noch bei uns zu melden. Diese Bitte gilt natürlich für alle von sexualisierter Gewalt Betroffene.
Ich kann nur um Verzeihung bitten für das, was ich oder meine Mitarbeitenden Betroffenen sexualisierter Gewalt in unserem Bistum durch unser Handeln oder Nichthandeln an neuen Verletzungen zugefügt haben. Es ist ihre Entscheidung, ob sie diese gewähren. Ich möchte versichern, dass die Erkenntnisse uns erneut in die Pflicht nehmen, dafür zu sorgen, dass unser künftiges Handeln noch stärker betroffenenorientiert wird und dass ich als Bischof alles tun werde, um unsere Vorgehensweise in diesem Sinn immer weiter zu verbessern.
Dabei hilft uns der vorliegende Bericht, weil er durch seine tiefgehende Recherche sehr plastisch zeigt, warum manche Fehler passieren konnten oder warum es Versäumnisse gab. Er zeigt aber auch, dass ich und meine Mitarbeitenden keinen dieser Fehler aus bösem Willen oder vorsätzlich begangen haben.
Der Bericht hält mir und denen, die mit mir Verantwortung tragen für die Bearbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt, den Spiegel über unser Tun vor: Wir sehen die Fortschritte und Entwicklungen, die es seit 2010 gegeben hat. Aber wir sehen eben auch deutlich die Grenzen, die Inkongruenzen im Vorgehen, die langwierigen Prozesse, den Nachholbedarf, den wir als Kirche auch etwa im Bereich der kirchlichen Rechtsprechung hatten und zum Teil noch haben.
Mein Respekt gilt der Hauptautorin der Studie, Frau Dr. Lena Haase, und dem Hauptautor, Herrn Prof. Dr. Raphael, die zusammen mit weiteren Mitarbeitenden eine detaillierte Studie zum Umgang mit sexuellem Missbrauch über einen Zeitraum von 20 Jahren verfasst haben. Von Seiten des Bistums haben wir alle von den Forschenden angefragten Akten und Materialien zur Verfügung gestellt; aber der Bericht zeigt, wie wichtig für die Aufarbeitung auch die persönlichen Gespräche mit Betroffenen und Zeitzeugen sind.
Blick auf einzelne Aspekte
Sicherlich werden wir Verantwortliche im Bistum den Zwischenbericht in seiner Gänze erst nach und nach erfassen und bearbeiten können, ebenso wie die Empfehlungen der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier, die wir in den letzten Jahren fortlaufend aufgenommen haben. Ich werde die Studienautorin und den Studienautor um ein Gespräch bitten, um manche Punkte noch besser nachvollziehen zu können. Aber schon jetzt zeigt sich, dass die Aufarbeitung längst nicht abgeschlossen ist.
Auf einige wenige Aspekte will ich heute schon eingehen.
Verantwortung als Ortsbischof und „Missbrauchsbeauftragter”
Der Bericht arbeitet die verschiedenen Phasen heraus, die sich in meiner Amtszeit ereignet haben. Das Ende des Untersuchungszeitraums fällt fast zusammen mit dem Ende meiner Aufgabe als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes. Es ist aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass der Bericht diese Aufgabe nicht näher beleuchtet. Für mich sind aber beide Aufgaben – die des Beauftragten und die als Ortsbischof – nicht voneinander zu trennen. Die Aufgabe als Beauftragter hat meinen Blick für die Thematik und für das, wofür ich als Ortsbischof Verantwortung trage, geschärft – aber sie hat mir manchmal auch Grenzen gesetzt: Denn mir war es wichtig, die Regeln und Vorgaben, die wir auf der Ebene der Bischofskonferenz und mit dem UBSKM-Amt der Bundesregierung jeweils vereinbarten, im eigenen Bistum getreu anzuwenden. Dadurch entstand mitunter der Eindruck, dass wir im Bistum zögerlich oder nicht proaktiv genug vorgehen.
Die Phasen der Aufarbeitung und ihre Auswirkungen
Der Bericht gibt einen sehr differenzierten Einblick in das ernsthafte Ringen um das richtige Handeln in den letzten rund 15 Jahren im Hinblick auf die Bekämpfung sexueller Gewalt im Bistum Trier.
Wenn der Bericht von „turbulenten Anfängen (2010-2013)” spricht, kann ich das durch meine Wahrnehmung bestätigen: Im Jahr 2010 und in den folgenden Jahren sind wir angesichts der Vielzahl von Meldungen und deren Bearbeitung sicher nicht in jedem Fall mit der Intensität und Achtsamkeit vorgegangen, wie wir dies später gemacht haben mithilfe der Regeln und Instrumente, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben.
Lag der Fokus zunächst stark auf der Ermutigung von Betroffenen, sich zu melden, haben wir die von den Forschenden als „Routinen (2014-2018)” benannte Phase genutzt, um die Verfahren in ihrer Bearbeitung einheitlicher und transparenter zu gestalten. Damit einher gingen überarbeitete Leitlinien und neue Regelwerke mit einer stärker technisch-juristisch geprägten Sprache. Die Studie konstatiert hier eine Verlagerung der Perspektive, eher weg von den Bedarfen der Betroffenen. Dem kann ich selbstkritisch zustimmen.
Ich hoffe sehr, dass wir das in der Phase der „Kurskorrekturen (2019-2021)” wieder verbessern konnten und unsere Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Belange der Betroffenen gerichtet haben. Bis heute überprüfen wir immer wieder unsere Kommunikation mit Betroffenen. Seit meinem Amtsantritt stehe ich für Gespräche zur Verfügung, wenn Betroffene das wünschen, und wir suchen aktiv den Kontakt zu uns bekannten Betroffenen, wenn wir wissen, dass es in „ihrem Fall” neue Entwicklungen gibt. Mit dem „Leitfaden bei Anliegen zur individuellen Aufarbeitung und Aufklärung von Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum Trier” zeigen wir die Möglichkeiten der individuellen Aufarbeitung auf und sind damit einer Empfehlung der Unabhängigen Aufarbeitungskommission gefolgt. Wir bieten mittlerweile traumasensible Seelsorge und rasch verfügbare therapeutische Hilfe für Betroffene an.
Grenzen und Dilemmata
Trotzdem geraten wir bei der Bearbeitung von Fällen immer wieder an den Punkt, dass wir im Sinne der Betroffenen zu schnellen Ergebnissen kommen wollen, sich die Komplexität eines Falles aber erst nach und nach herausstellt. Ich erinnere nur daran,
- dass wir kirchlicherseits unsere Voruntersuchungen aussetzen, solange eine Staatsanwaltschaft ermittelt;
- dass es Fälle gibt, in denen während der Bearbeitung neue Meldungen oder Erkenntnisse eingehen;
- dass wir einem Vorwurf auch dann weiter nachgehen wollen, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt hat, ohne dass wir all die Instrumente haben, über die staatliche Ermittlungsbehörden verfügen;
- dass wir an die Grenzen stoßen, die der Datenschutz uns seit dem Jahr 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) auferlegt.
Der vorliegende Bericht führt dazu, dass wir kritisch auf unsere personelle Ausstattung im Bereich Prävention – Intervention – Aufarbeitung schauen werden.
Ich befürchte, dass wohl auch in Zukunft eine Diskrepanz bleiben wird zwischen dem, was wir als Verantwortliche an Aufklärung und Aufarbeitung leisten können und was Betroffene sich erhoffen und erwarten. Wir werden in der Kommunikation miteinander auch künftig an Grenzen stoßen. Wir werden trotz aller professionellen und breit aufgestellten Präventionsarbeit nicht verhindern können, dass Menschen im Raum der Kirche Opfer von sexueller Gewalt werden. Und wir werden auch weiterhin vermutlich trotz aller Professionalität und gutem Willen Fehler machen.
Folgerungen
Die Studie zeigt deutlich die Last, die durch das jahrzehntelange Schweigen auf Betroffenen gelegen hat. Sie zeigt darüber hinaus die Belastung, die die individuelle und institutionelle Aufarbeitung seit 2010 mit sich gebracht hat: für die unmittelbar Betroffenen, aber auch für die sekundär Betroffenen. Dabei denke ich insbesondere an Menschen in unseren Gemeinden, mit denen wir in manchen früheren Fällen auch nicht angemessen umgegangen sind, indem wir zu spät oder unzureichend informiert haben. Aber ich denke auch an die Belastungen für alle, die sich um Aufklärung und Aufarbeitung bemüht haben.
Ich bin froh um jene, die mich in meiner Verantwortung als Bischof unterstützt haben und unterstützen. Meine und unsere Arbeit an diesem Thema ist nicht beendet. Die intensive Befassung mit sexuellem Missbrauch im Raum der Kirche hat zudem den Blick geweitet auf Fragen des Machtmissbrauchs insgesamt. Wenn die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier ihre Arbeit entsprechend der Gemeinsamen Erklärung zwischen der Bischofskonferenz und der Bundesregierung 2026/2027 beendet, wird es eine intensive Befassung mit dem Gesamtergebnis der Aufarbeitung in unserem Bistum brauchen. Die Überlegungen dazu haben schon begonnen. Dazu gehört die Frage nach einer angemessenen Erinnerungskultur. Auf die Wichtigkeit dieses Themas weist auch die UAK in ihrer aktuellen Stellungnahme hin. Und ich werde weiterhin jedes Jahr Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit ablegen, was das Bistum in den Bereichen Prävention, Intervention und Aufarbeitung tut.
Die zurückliegenden 15 Jahre haben uns die zerstörerische Dynamik des Missbrauchs sehen gelehrt. Deshalb will ich zusammen mit meinen Mitarbeitenden weiterhin alle notwendigen Kräfte dafür einzusetzen, um das Verbrechen des Missbrauchs in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen entschieden zu bekämpfen. " (Quelle: "bistum-trier.de")