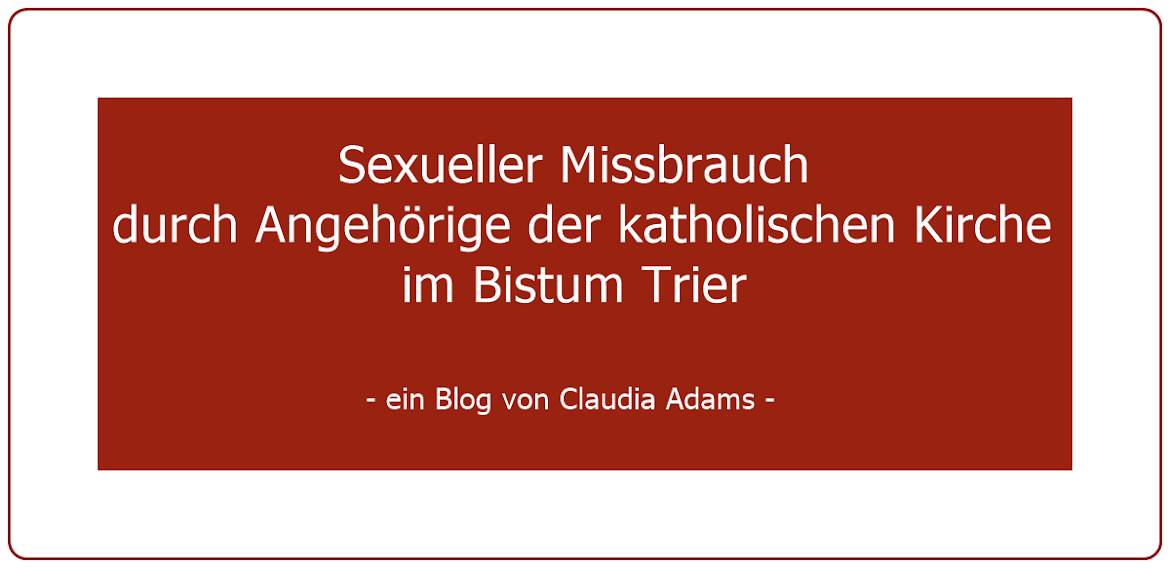(Fotoquelle: Bistum Trier)
Zimmer selbst ist Teil des Systems und vertritt als Präventionsbeauftragter des Bistums Trier genau jene Institution, die systematisch Missbrauch ermöglicht, vertuscht und Täter geschützt hat. Er arbeitet nicht im Auftrag einer neutralen, unabhängigen Stelle, sondern innerhalb des Machtapparates, der Betroffene zutiefst verletzt hat.
"Was der Täter dir erzählt hat, war falsch"
So will das Bistum Trier Missbrauchsbetroffene spirituell begleiten
direkt zum Artikel auf "katholisch.de"Heilung durch die Täterorganisaton? Warum das neue „traumasensible“ Seelsorge-Angebot des Bistums Trier un-glaubwürdig erscheint.
Das Bistum Trier präsentiert ein neues Angebot: Geistliche Begleitung für Missbrauchsbetroffene. Es soll helfen, „toxische Glaubensinhalte“ zu verarbeiten, die Täter missbraucht haben, um ihre Opfer zu manipulieren. Klingt auf den ersten Blick nach Fürsorge. Doch bei genauerem Hinsehen drängt sich die Frage auf: Kann man wirklich mit der gleichen Quelle heilen, aus der die Verletzung stammt? - Wohl kaum.
Das Bistum Trier präsentiert ein neues Angebot: Geistliche Begleitung für Missbrauchsbetroffene. Es soll helfen, „toxische Glaubensinhalte“ zu verarbeiten, die Täter missbraucht haben, um ihre Opfer zu manipulieren. Klingt auf den ersten Blick nach Fürsorge. Doch bei genauerem Hinsehen drängt sich die Frage auf: Kann man wirklich mit der gleichen Quelle heilen, aus der die Verletzung stammt? - Wohl kaum.
Ein unauflösbarer Widerspruch: Heilung in den Strukturen des Täters
Für viele Betroffene ist die Kirche nicht nur „Ort der Tat“, sondern die Institution, die Missbrauch ermöglicht, gedeckt und verharmlost hat. Das Bistum bietet jetzt "Heilung" an – aber innerhalb der gleichen Strukturen. Das ist, als würde man einem Brandopfer sagen: „Komm, wir löschen deine Wunden im Haus des Brandstifters.“ Die seelische Verletzung ist untrennbar mit kirchlichen Symbolen, Räumen, Rollen und Sprache verbunden. Wer dorthin zurückgeführt wird, läuft Gefahr, die ursprüngliche Ohnmacht erneut zu erleben.
Die unterschätzte Trigger-Gefahr
Im Interview wird kaum thematisiert, wie massiv religiöse Sprache selbst nach Jahren als Trigger wirken kann. Begriffe wie „der liebe Gott“, „die Kirche lehrt…“ oder das Bild vom allwissenden Priester sind für viele Betroffene keine neutrale Glaubenssprache, sondern Tatwerkzeuge. Sie wurden gezielt eingesetzt, um Schuld, Angst und Unterwerfung zu erzeugen. Im kirchlichen Umfeld – selbst mit sogenannten „traumasensiblen“ Begleitern – kann jede Predigtgeste, jedes Kreuz, jeder liturgische Satz ein Flashback auslösen. Die Gefahr, dass hier Retraumatisierung statt Heilung passiert, ist enorm – und wird hier völlig verharmlost.
„Auf Wunsch der Betroffenen“ – oder nur einer kleinen Minderheit?
Zimmer betont, das Angebot gebe es, „weil Betroffene es gewünscht haben“. Was er nicht sagt: Es handelt sich um eine kleine, sehr spezifische Gruppe von Betroffenen – vermutlich jene, die trotz Missbrauchs im kirchlichen Kontext weiter an religiöser Praxis interessiert sind. Der überwältigende Teil der Betroffenen lehnt ein solches Projekt ab, weil es den Ort der Gewalt und die Symbolik der Täterinstitution nicht trennen kann. Das Problem: Die Kirche verkauft den Wunsch einer kleinen Minderheit als generellen Bedarf, um ein Projekt zu legitimieren, das am Ende vor allem kirchliche Eigenlogik bedient. Für die Mehrheit, die Abstand zur Kirche sucht, ist dieses Angebot nicht nur nutzlos, sondern potenziell retraumatisierend.
Die Kirche behält den Deutungsrahmen
Selbst wenn Begleiter*innen formal unabhängig wirken, bleiben sie Ausgebildete in kirchlicher Spiritualität. Die Deutungsrahmen – was „richtige“ und „falsche“ Glaubensinhalte sind – werden nicht von außen bestimmt, sondern bleiben im kirchlichen Einflussbereich. Das Risiko: Anstatt den Glauben völlig frei und individuell zu rekonstruieren, geschieht die Verarbeitung innerhalb der Grenzen, die die Kirche implizit vorgibt.
Selbst wenn Begleiter*innen formal unabhängig wirken, bleiben sie Ausgebildete in kirchlicher Spiritualität. Die Deutungsrahmen – was „richtige“ und „falsche“ Glaubensinhalte sind – werden nicht von außen bestimmt, sondern bleiben im kirchlichen Einflussbereich. Das Risiko: Anstatt den Glauben völlig frei und individuell zu rekonstruieren, geschieht die Verarbeitung innerhalb der Grenzen, die die Kirche implizit vorgibt.
Imagepflege unter dem Deckmantel von Fürsorge
Das Angebot wird als Reaktion auf ein „Versagen der Kirchenleitung“ verkauft.
Aber:
Keine Rede von strukturellen Konsequenzen. Keine transparente Aufarbeitung, wie viele Täter sich genau dieser „geistlichen Autorität“ bedient haben. Keine Offenlegung, wie dieses Missbrauchsmuster intern lange gedeckt wurde. So wirkt das Projekt wie eine Gelegenheit, sich als lernende und fürsorgliche Institution darzustellen – ohne die Machtstrukturen anzugreifen, die das Problem erst geschaffen haben.
Vermischung von Aufarbeitung und Glaubensarbeit
Heilung wird im Artikel klar an Spiritualität gekoppelt.
Das Problem: Wer Glaubensarbeit mit Aufarbeitung verknüpft, läuft Gefahr, beides zu vermischen.
Betroffene, die eigentlich nur ihre Traumata bearbeiten wollen, werden so doch wieder in einen religiösen Kontext zurückgeführt – auch wenn das subtil und unbeabsichtigt passiert.
Fehlende unabhängige Kontrolle
„Kritik erwünscht“ klingt gut, ist aber kein Ersatz für externe Aufsicht. Wer stellt sicher, dass dieses Angebot nicht irgendwann zur stillen Re-Evangelisierung wird? Wer kontrolliert, ob kirchliche Begleiter*innen nicht doch (bewusst oder unbewusst) kirchliche Dogmen in die Begleitung einfließen lassen? Ohne neutrale Prüfinstanz ist dieses Projekt ein Selbstversuch der Institution – und die hat historisch bewiesen, dass sie ihre eigenen Fehler nur ungern offenlegt.
Die große, unbeantwortete Frage
Am Ende bleibt die Frage: Kann man Betroffenen von spirituellem Missbrauch wirklich zumuten, ausgerechnet in den Räumen und mit den Symbolen der Institution Heilung zu suchen, die sie verletzt hat? - Die Kirche mag sagen: „Wir haben gelernt.“ Aber wer missbraucht wurde, weiß: Lernen allein macht Täterstrukturen nicht sicher.
Solange die Kirche nicht bereit ist, diese Begleitung konsequent außerhalb ihrer eigenen Strukturen anzubieten – finanziert, aber unabhängig –, bleibt dieses Angebot ein gefährlicher Spagat:
Zwischen ehrlichem Hilfsversuch und institutioneller Selbstentlastung.
Für viele Betroffene wird dies kein Weg zur Heilung sein, sondern ein erneuter Gang durch das Minenfeld ihrer eigenen Vergangenheit.