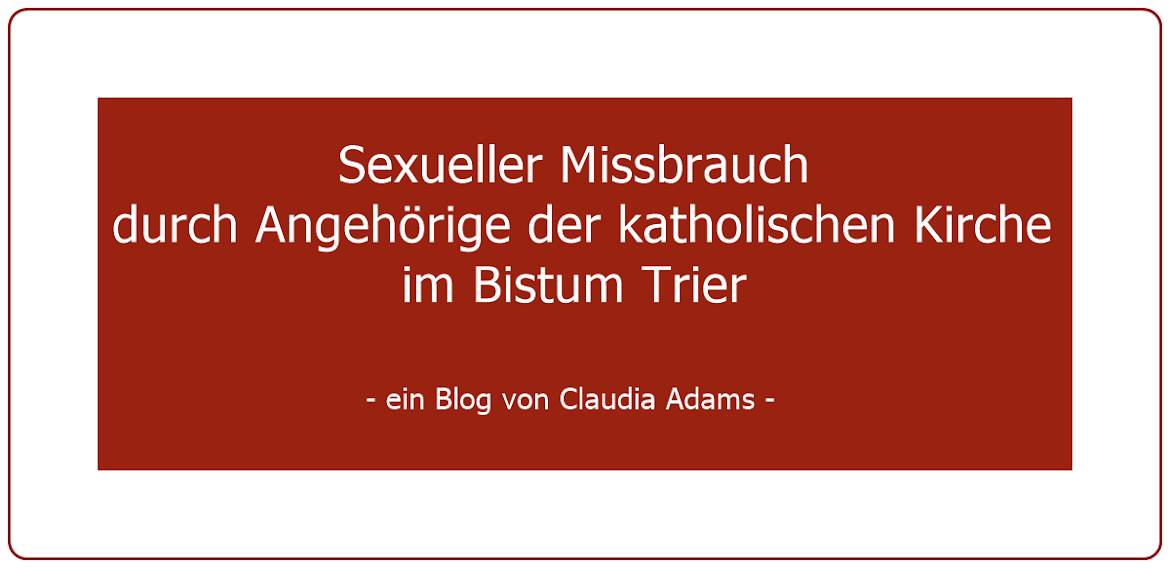„Können Sie etwas zur Vermutung eines Pädophilen-Netzwerks sagen?“
„Nein, das ist zu früh. Es ist offen, ob wir da einen Fuß in die Tür bekommen.“
(Oberstaatsanwalt Hromada zur Causa Dillinger, SZ, 15.05.2023)
Wenn ein ehemalige Generalstaatsanwalt auf die naheliegende Frage nach einem pädophilen Netzwerk so ausweicht – dann lässt diese Aussage tief blicken. Und es ist klar: Hier besteht erheblicher Aufklärungsbedarf.
Gibt es ein pädophiles Netzwerk im Bistum Trier?
Die bekannten Fakten sprechen eine Sprache, die kaum noch anders zu deuten ist:
- Edmund Dillinger konnte über Jahrzehnte hinweg ungehindert Kinder missbrauchen – nicht trotz, sondern wegen seiner Stellung und dem Schutz durch das System "katholische Kirche"
- Es gibt mindestens 20 Betroffene – und das sind nur die dokumentierten Fälle
- In den Ermittlungsakten werden mindestens vier weitere kirchliche Amtsträger erwähnt, darunter auch heute noch aktive Geistliche.
- Nach Dillingers Tod kam es zu ungeklärten Einbrüchen, verschwundenen Beweismitteln und einer nicht nachvollziehbaren Aktenvernichtung.
- Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken verweigert bis heute die Akteneinsicht – trotz öffentlichem Interesse.
Zufall? - Ganz sicher nicht. Handelt es sich nicht eher um reflexartige Abwehrversuche, Kontrolle über ein Narrativ zu behalten, das längst außer Kontrolle geraten ist?
Denn je mehr ans Licht kommt, desto plausibler wird der Verdacht, dass es sich hier nicht um einzelne Täter, sondern um ein strukturell gedecktes Netzwerk handelt: Pädophile Serientäter. Im Namen des Herrn. Oder genauer: Im Namen des Bistums Trier.
Ein Netzwerk muss kein Geheimbund sein.
Es reicht, wenn Menschen sich gegenseitig decken, wenn Verantwortung systematisch verschoben, wenn Aufklärung verhindert und Betroffene zum Schweigen gebracht werden. Wenn Mitwissende schweigen oder: sich im Beichtstuhl gegenseitig die Sünden vergeben.
Dieses Muster ist im Bistum Trier gut zu erkennen.
Was sich in den letzten Jahren geändert hat?
Nicht etwa, dass Missbrauch verhindert oder transparent aufgearbeitet würde. Geändert hat sich vor allem eins: Die Instrumente der Vertuschung wurden verschärft. Die Methoden wurden moderner. - Doch das Muster bleibt gleich: Früher verschwanden Akten in den Archiven der Bistümer, blieben in den Händen derer, die vertuschten, wurden vernichtet und gelangten nie zur Staatsanwaltschaft.
Heute ermittelt die Staatsanwaltschaft – und dennoch verschwinden Beweismittel, werden Akten gelöscht, wird Einsicht verweigert.
Ausgerechnet in einem der sensibelsten Missbrauchskomplexe, den das Bistum Trier je erlebt hat.
Ein Fortschritt? - Wohl kaum. Eher ein besser organisierter Selbstschutz. Was sich geändert hat? Dass einiges auf staatlichen Beistand hindeutet.
Es geht nicht um Aufklärung, sondern um Kontrolle
Warum werden Namen geschützt? Warum schweigen Verantwortliche?
Weil das System sich selbst schützt. Nicht, weil es um Aufklärung geht – sondern offensichtlich um Schadenskontrolle.
Genau deshalb ist die Frage nach einem pädophilen Netzwerk nicht nur berechtigt, sondern zentral.
Denn es geht nicht mehr um Einzelpersonen.
Es geht um Strukturen, die Täter ermöglicht haben.
Es geht um Institutionen, die lieber Akten vernichten als Verantwortung übernehmen.
Und: Es geht um die Betroffenen, die ein Recht auf Wahrheit haben.
Wer im Namen der Kirche Kinder missbraucht – und von der Kirche geschützt wird – ist nicht nur Täter, sondern Teil eines Systems.
Dillinger missbrauchte über Jahrzehnte hinweg Kinder – nicht trotz, sondern durch seine Stellung im Bistum Trier.
Und wer heute noch schweigt, schützt nicht die Kirche: er schützt die Täter.
Oder: Er steckt selbst mit im Sumpf.
Claudia Adams