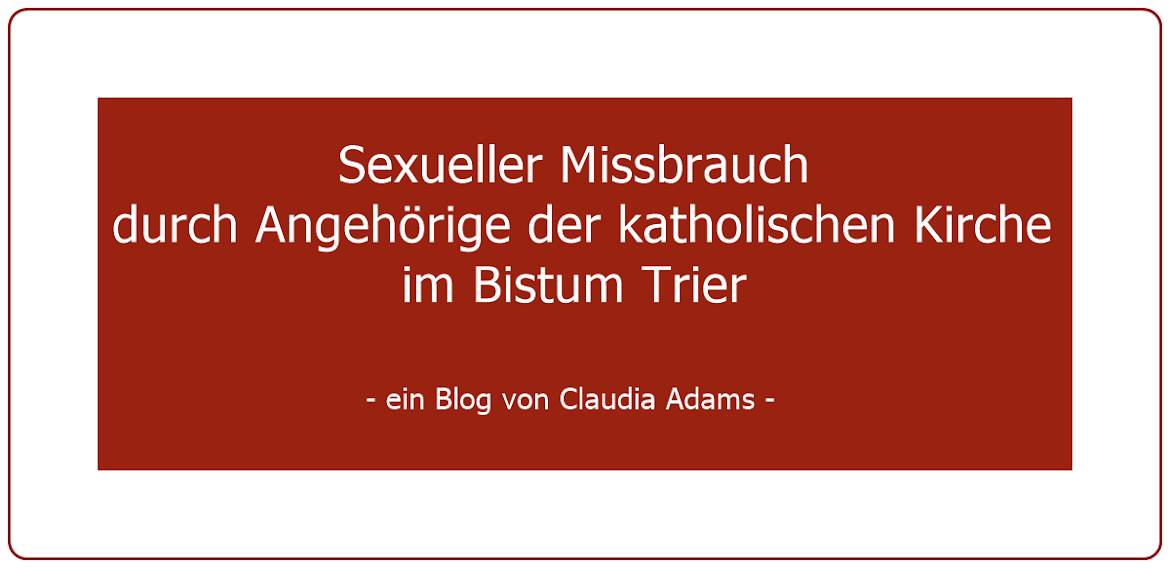Neue Dekrete und Richtlinien treten ab 01. April 2024 in Kraft
Nr. 81
Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten von
Betroffenen sexuellen Missbrauchs und Dritten in Sachakten des
Bistums Trier
__________________________________________________________
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen sexuellen Missbrauchs (Betroffene) und Dritten in Sachakten des Bistums Trier.
(2) Als Betroffene im Sinne dieser Ordnung gelten Personen ab dem Zeitpunkt der Bestätigung der Plausibilität eines Hinweises gemäß Ziffer 20 der Interventionsordnung für das Bistum Trier in seiner jeweils gültigen Fassung1.
(3) Dritte im Sinne dieser Ordnung sind Personen, die ein eigenes Recht im Sinne des § 4 geltend machen können.
(4) Die Rechte zur Einsichtnahme in bereits archivierte Sachakten sind gesondert in der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO)2 geregelt.
(5) Diese Ordnung regelt keine Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen oder Dritten in Personalakten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Trier.
(6) Die Rechte zur Einsichtnahme in Personalakten und auf Auskünfte aus den Personalakten von Klerikern sind gesondert in der Personalaktenordnung (PAO)3 geregelt. Demnach besteht grundsätzlich ein Auskunftsrecht für Betroffene in diese Akten, wenn diese auf konkrete Anfragen hin eine Auskunft beantragen (§ 15 PAO).
(7) Die Bestimmungen der Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten für die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für Rechtsanwaltskanzleien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten und vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung (OEAS) bleiben unberührt.
§ 2 Verhältnis zum KDG
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten finden das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) und die zu seiner Durchführung ergangenen Vorschriften, insbesondere die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung.
(2) Personen, denen personenbezogene Daten durch die Gewährung von Einsicht in oder die Erteilung von Auskünften aus Sachakten offenbart werden, müssen auf die Vertraulichkeit im Umgang mit diesen Daten verpflichtet werden, sofern sie nicht einer entsprechenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Das Nähere regeln die Richtlinien zur Regelung des Verfahrens zur Akteneinsicht und Aktenauskunft an betroffene Personen und Dritte.
§ 3 Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen in Sachakten
(1) Betroffene haben ein Einsichtsrecht in und ein Auskunftsrecht aus Unterlagen von Sachakten, die einen Bezug zu dem sie betreffenden Missbrauchsvorwurf oder der Missbrauchstat haben. Sachakten i. S. dieser Ordnung sind insbesondere
• Verfahrensakten der oder des Interventionsbeauftragten des Bistums Trier gemäß § 1 Abs. 3 der Richtlinien zur Regelung des Verfahrens zur Akteneinsicht und Aktenauskunft an Betroffene sexuellen Missbrauchs und Dritte,
• vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung i. S. der Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten für die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für Rechtsanwaltskanzleien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten und vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung (OEAS)
• sowie Unterlagen gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3-6 Allgemeines Dekret über die Verwaltung des Geheimarchivs (ADVG), vorbehaltlich staatlicher Vorgaben sowie entgegenstehender Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte), die gemäß § 4 Abs. 3 lit. a ADVG verwaltet werden.
(2) Im Rahmen der Einsichtnahme sind die personenbezogenen Daten Dritter, mit Ausnahme derjenigen der beschuldigten Personen sowie in Verantwortung stehenden Personen des Bistums Trier, vor der Kenntnisnahme zu schützen. Dies erfordert gegebenenfalls eine Anonymisierung oder eine Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten Dritter vor der Einsichtnahme.
(3) Der Einsicht nehmenden Person ist das Erstellen von Aufzeichnungen (z. B. Abschriften, Ton oder Bildaufzeichnungen) von den ihr zur Einsichtnahme vorgelegten Unterlagen untersagt. Soweit es im Einzelfall rechtlich zulässig ist, erstellt das Bistum auf Antrag Kopien und händigt sie der Einsicht nehmenden Person aus.
(4) Der Ablauf der Einsichtnahme und der Auskunftserteilung wird durch eine Verwaltungsvorschrift des Bischöflichen Generalvikars genauer geregelt.4
(5) Auf Wunsch der Betroffenen ist die Auskunft durch eine Notarin oder einen Notar zu erteilen. Diese sind als Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger in besonderem Maße auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und der Achtung der Persönlichkeitsrechte Dritter verpflichtet. Sie erhalten in nicht anonymisierter oder pseudonymisierter Form Einsicht in die betreffenden Sachakten und erteilen im Anschluss die gewünschte Information unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
§ 4 Einsichts- und Auskunftsrechte Dritter in Sachakten
(1) Dritte haben ein Einsichtsrecht in und ein Auskunftsrecht aus Unterlagen von Sachakten, sofern sie einen Bezug zu dem verstorbenen Betroffenen, dem betreffenden Missbrauchsvorwurf oder der Missbrauchstat haben. Dritte sind insbesondere Ehepartnerinnen und Ehepartner, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner nach Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) oder in lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebende Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, Kinder, Eltern und Geschwister.
(2) Dritte müssen mit Antragstellung schriftlich darlegen, dass die Einsicht und Auskunft zur Verfolgung eines noch nicht verjährten geerbten Schmerzensgeldanspruchs oder zur Abwehr einer Beeinträchtigung des postmortalen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen erfolgt.
(3) Die Regelungen des § 3 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(2) Sie soll spätestens nach Ablauf des zweiten Jahres ihrer Geltung einer Prüfung unterzogen werden.
1 Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (Interventionsordnung), in: KA 2020 Nr. 2, KA 2022 Nr. 278.
2 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO), in: KA 2014 Nr. 60, KA 2016 Nr. 227.
3 Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern (Personalaktenordnung), in: KA 2021 Nr. 259. 4 KA 2025 Nr. 83
Trier, den 14. Februar 2025
(Siegel)
Dr. Stephan Ackermann
Bischof von Trier
Nr. 82
Allgemeines Dekret über die Verwaltung des Geheimarchivs
___________________________________________________________________
§ 1 Archivgut
(1) Archivgut im Sinne dieses Dekretes sind Dokumente, deren Geheimhaltung durch eine kirchenrechtliche Norm oder aufgrund der Natur der Sache verlangt ist1 und die an einem sicheren Ort fest verschlossen mit größter Sorgfalt aufzubewahren sind (can. 489 §1 CIC).
(2) Dazu gehören:
1. das Register über geheim erteilte eherechtliche Dispense gemäß can. 1082 CIC;
2. das Register über geheim geschlossene Ehen gemäß can. 1113 CIC;
3. Verwarnungen und Verweise gemäß can. 1339 §3 CIC;
4. die Akten der Voruntersuchungen gemäß can. 1719 CIC;
5. die Akten der gerichtlichen oder außergerichtlichen Strafverfahren bei Sittlichkeitsdelikten gemäß can. 489 §2 CIC;
6. Akten der staatlichen Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, die Kleriker betreffen2;
7. forensisch-psychiatrische Gutachten über Kleriker3;
8. die Dokumente, die dem päpstlichen Geheimnis unterliegen4, insbesondere alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Wahl eines Diözesanbischofs5;
9. die versiegelten Originalakten der diözesanen Untersuchung in einem Seligsprechungsverfahren6;
10. weitere Vorgänge und Akten, für die der Bischof die Archivierung aus schwerwiegenden und gerechten Gründen als notwendig erachtet.
§ 2 Aufbewahrungsfristen
Soweit nicht durch eine spezielle Norm oder von der zuständigen Autorität etwas anderes festgelegt ist, sind diese Dokumente unbefristet und dauerhaft zu verwahren (cann. 486 §1 und 489 §2 CIC).
§ 3 Standort
(1) Das Geheimarchiv besteht aus zwei Teilen, einem im Bistumsarchiv und einem im Bischöflichen Generalvikariat.
(2) Abgeschlossene Vorgänge werden gesondert im Bistumsarchiv verwahrt.
(3) Vorgänge, die noch lebende Personen betreffen oder noch nicht endgültig abgeschlossen sind, verbleiben in gesicherten Schränken im Bischöflichen Generalvikariat.
§ 4 Berechtigter Zugang
(1) Ausschließlich der Bischof und – im Fall der Sedisvakanz – der Diözesanadministrator haben unbeschränkten Zugang zum Geheimarchiv (can. 490 §§ 1-2 CIC).
(2) Der Generalvikar hat von Amts wegen Zugang zu den Dokumenten dieses Archivs, deren Nutzung zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlich sind.
(3) Der Bischof kann einzelnen Personen Zugang gewähren,
a) wenn sie in seinem Auftrag tätig werden sollen in Angelegenheiten, für deren Erledigung der Zugriff auf die Dokumente erforderlich ist.
b) Dieser Auftrag wie auch sein Umfang müssen schriftlich erteilt bzw. bestimmt werden.
c) Die Personen, die auf diese Weise Zugang zu Teilen des Geheimarchivs erhalten, haben das Amtsgeheimnis zu wahren.7
§ 5 Herausgabe von Akten
(1) Gemäß can. 490 §3 CIC gilt grundsätzlich, dass aus dem Geheimarchiv außer an die in §4 genannten Personen keine Dokumente an Dritte herausgegeben werden dürfen.
(2) Ausnahmen sind nur möglich für Dokumente, die nicht dem päpstlichen Geheimnis unterliegen8, und zwar dann, wenn a) es das Wohl der Kirche und der Gläubigen erfordert,
b) nur so ein Ärgernis behoben oder die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann9,
c) nur so eine Person ihre Rechte geltend machen10 oder ein ihr widerfahrenes Leid bearbeiten kann11.
(3) Voraussetzung für die Herausgabe von Akten bzw. Dokumenten an Dritte ist
a) entweder ein vom Bischof erteilter Forschungsauftrag wie auch ein von ihm angenommenes Forschungsbegehren
b) oder ein im Sinne von Abs. 2 begründeter Antrag einer Einzelperson, der vom Bischof zu genehmigen ist.
(4) Der Umfang der herauszugebenden Akten bzw. Dokumente muss sich nach dem tatsächlich notwendigen Bearbeitungsbedarf richten.
(5) Die Herausgabe umfasst je nach Dokument eine Auskunft über dessen Inhalt oder eine Einsichtnahme, nicht aber die Ablichtung des Dokuments.
(6) Andere rechtliche Bestimmungen, die den Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen oder den Umgang mit Dokumenten, sind zu beachten.
(7) Die Herausgabe von Dokumenten ist schriftlich zu dokumentieren, ebenso wie die Rückgabe.
(8) Den Personen, die auf diese Weise Zugang zu Teilen des Geheimarchivs erhalten, werden die Informationen unter Gewährleistung der Vertraulichkeit gegeben, um die schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte aller beteiligten Personen zu wahren.12
§ 6 Inkrafttreten
Dieses Dekret tritt am 1. April 2025 in Kraft.
1 Vgl. Päpstliche Kommission für die Instrumente der sozialen Kommunikation, Pastoralinstruktion Communio et progressio (23. Mai 1971), Nr. 121, in: Nachkonziliare Dokumente, Bd.11: „Geheimhaltung muss daher unbedingt auf solche Fälle begrenzt bleiben, bei denen es um den Ruf und das Ansehen eines Menschen geht oder andere Rechte einzelner bzw. von Gruppen verletzt würden.“
2 In Analogie zu cann. 489 §2 und 1719 CIC.
3 Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst, Nrn. 43 und 52, in: Kirchlisches Amtsblatt für das Bistum Trier KA 2020 Nr. 2, KA 2022 Nr. 278.
4 Secretaria Status, Rescriptum ex audientia, Instructio Secreta continere (4. Februar 1974), Art. I n. 4, in: AAS 66 (1974), 89-92; Secretaria Status, Rescriptum ex audientia, Instructio De causibus reservatione (6. Dezember 2019), Nrn. 1-2, in: AAS 112 (2020), 72-73.
5 Instructio Secreta continere (4. Februar 1974), Art. I n. 7.
6 Vgl. Congregatio de Causis Sanctorum, Instructio Sanctorum Mater (17. Mai 2007), Art. 145 §§ 2-3, in: AAS 99 (2007), 465-510.
7 Vgl. can. 471, n. 2 CIC; Instructio Über die Vertraulichkeit der Fälle (6. Februar 2019), Nrn. 3-4.
8 Vgl. Instructio Über die Vertraulichkeit der Fälle (6. Februar 2019), Nr. 1.
9 Vgl. can. 1341 CIC.
10 Vgl. can. 487 §2 CIC.
11 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben in Form eines Motu Proprio „Vos estis lux mundi“ (7. Mai 2019/25. März 2023), Vorwort: „Die Verbrechen sexuellen Missbrauchs beleidigen unseren Herrn, verursachen physische, psychische und spirituelle Schäden bei den Opfern und verletzen die Gemeinschaft der Gläubigen. Damit solche Phänomene in all ihren Formen nicht mehr geschehen, braucht es eine ständige und tiefe Umkehr der Herzen, die durch konkrete und wirksame Handlungen bezeugt wird …“.
12 Vgl. Instructio Über die Vertraulichkeit der Fälle (6. Februar 2019), Nr 3. Es gilt aber auch Nr. 5: „Demjenigen, der Meldung erstattet, der Person, die aussagt, geschädigt worden zu sein, und den Zeugen kann in keiner Weise eine Schweigepflicht hinsichtlich des Tatsachenbestandes auferlegt werden.“
Trier, den 14. Februar 2025
(Siegel)
Dr. Stephan Ackermann
Bischof von Trier
Nr. 83
Richtlinien zur Regelung des Verfahrens zur Akteneinsicht und Aktenauskunft an Betroffene sexuellen Missbrauchs und Dritte
___________________________________________________________
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Richtlinien regeln das Verfahren zur Durchführung der Einsicht in Personal- und Sachakten sowie zu einer Auskunft aus Personal und Sachakten an Betroffene sexuellen Missbrauchs (Betroffene) und an Personen, die keine Betroffenen oder Mitarbeitenden des Bistums Trier sind (Dritte). Dritte im Sinne dieser Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten von Betroffenen sexuellen Missbrauchs und Dritten sind Ehepartnerinnen und Ehepartner, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) oder in lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebende Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, Kinder, Eltern und Geschwister.
(2) Die §§ 3 ff. finden keine Anwendung auf die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, Forschungseinrichtungen und Rechtsanwaltskanzleien.
(3) Sachakten im Sinne dieser Richtlinien sind insbesondere
• Verfahrensakten der oder des Interventionsbeauftragten des Bistums Trier; sie betreffen insbesondere Verfahren in Anerkennung des Leids, berufsgenossenschaftliche Verfahren, Verfahren über die staatliche Opferentschädigung, Ergänzendes Hilfesystem (EHS) beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie Verfahren zu Hilfen gemäß Ziffer 45 ff. der diözesanen Interventionsordnung,
• vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung im Sinne der Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten für die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für Rechtsanwaltskanzleien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten, Registraturakten und vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung (OEAS)1
• sowie Unterlagen gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3-6 Allgemeines Dekret über die Verwaltung des Geheimarchivs (ADVG), vorbehaltlich staatlicher Vorgaben sowie entgegenstehender Rechte Dritter (z. B. Urheber), die gemäß § 4 Abs. 3 lit. a ADVG verwaltet werden (Vorschriften über die Verwaltung des Geheimarchivs in der jeweils geltenden Fassung).
§ 2 Grundlagen
(1) Die Akteneinsicht ist der tatsächliche Einblick in Unterlagen einer Akte.
a. Für Personalakten haben grundsätzlich ein Einsichtsrecht:
aa. die Bediensteten gem. § 13 Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern (Personal aktenordnung – PAO)2 und gem. § 9 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)3. Das Einsichtsrecht können auch Hinterbliebene der Bediensteten haben; sie müssen jedoch ein berechtigtes Interesse an der Einsicht glaubhaft machen. Bedienstete und Hinterbliebene können das Recht selbst oder durch Bevollmächtigte wahrnehmen;
bb. Mitarbeitervertretungen gem. § 26 Abs. 2 Satz 2 Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO)4; cc. die Aufarbeitungskommissionen der (Erz-)Bistümer, Hochschulen und andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, Rechtsanwaltskanzleien für Personalakten Geistlicher gemäß der Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten Dritter in Bezug auf Personalaktendaten von Klerikern5;
dd. Betroffene und Dritte in Personalakten, die den Vorschriften der Archivordnung unterliegen, wenn sie die Voraussetzungen der Archivordnung für eine Einsichtnahme erfüllen (§ 8 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO)6.
Die Durchführung der Akteneinsicht in Personalakten ist in den Fällen der Doppelbuchstaben aa bis cc jeweils einem gesonderten Verfahren vorbehalten.
b. Für Sachakten nach § 1 Abs. 3 haben grundsätzlich ein Einsichtsrecht:
aa. Betroffene ab dem Zeitpunkt der Bestätigung der Plausibilität eines Hinweises gemäß Ziffer 20 der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (Interventionsordnung)7;
bb. die Aufarbeitungskommissionen der (Erz-) Bistümer, Hochschulen und andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, Rechtsanwaltskanzleien gemäß den Bestimmungen der OEAS (vgl. § 1 Abs. 2); cc. Dritte in Sachakten, die den Vorschriften der Archivordnung unterliegen, wenn sie die Voraussetzungen der Archivordnung für eine Einsichtnahme erfüllen (§ 8 KAO).
Die Durchführung der Akteneinsicht in Sachakten ist in den Fällen des Doppelbuchstabens bb einem gesonderten Verfahren vorbehalten.
Während eines laufenden Verfahrens wird Akteneinsicht der betroffenen Person nur in Begleitung eines Rechtsbeistandes gewährt.
c. Sofern sich aus anderen kirchlichen oder staatlichen Vorschriften die Rechte weiterer Personen auf Akteneinsicht in Personal- oder Sachakten ergeben, bleiben diese Rechte unberührt. Dies gilt insbesondere für eine Akteneinsicht im Rahmen kirchlicher und staatlicher strafrechtlicher Ermittlungs- oder Strafverfahren (vgl. §§ 18, 19 PAO) und staatlicher Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs.
(2) Ein Auskunftsrecht haben
a. die Personen und Personengruppen, die nach Absatz 1 einen Anspruch auf Akteneinsicht haben. Die Durchführung der Aktenauskunft zu Personalakten ist in den Fällen der Doppelbuchstaben aa bis cc des Buchstabens a des Absatzes 1 jeweils einem gesonderten Verfahren vorbehalten;
b. Betroffene bezogen auf die Personalakte der beschuldigten Person bzw. des Täters oder der Täterin nach Maßgabe des § 15 PAO;
c. Dritte, wenn die Auskunft zwingend erforderlich ist für die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder den Schutz berechtigter, höherrangiger Interessen der oder des Dritten gemäß § 15 PAO. „Dritte“ in diesem Sinne können auch Angehörige betroffener Personen sein, wenn sie die Voraussetzung nach Satz 1 erfüllen, oder Beschuldigte, wenn ihre Unschuld im Verfahren festgestellt wurde.
§ 3 Verfahren zur Antragstellung
(1) Antragsberechtigt ist, wer als Betroffener oder Dritter ein Einsichts- oder Auskunftsrecht hat.
(2) Die Antragstellung erfolgt in Textform oder zur Niederschrift unter Nutzung des Antragsformulars, das das Bistum hierfür zur Verfügung8 stellt. Das Formular enthält die Angaben, die für die Bearbeitung des Antrags erforderlich sind. Anträge, die nicht unter Nutzung des Formulars gestellt werden, können nicht bearbeitet werden. Dies gilt grundsätzlich nicht für Betroffene. Der Antrag ist zu richten an die Interventionsbeauftragte bzw. den -beauftragten des Bistums Trier.
(3) Die den Antrag stellende Person muss die Gründe für die gewünschte Akteneinsicht oder Auskunft möglichst vollständig darlegen.
(4) Soweit vorhanden, sollen Nachweise oder Belege für das berechtigte Interesse beigefügt werden.
§ 4 Entscheidungsverfahren
(1) Zuständige Stelle für die Entscheidung
a. über den Antrag auf eine Akteneinsicht gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. b9 oder eine Auskunft gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. c10 oder eine Auskunft gemäß § 2 Abs. 2 Buchst. c11 ist die oder der Interventionsbeauftragte;
b. über den Antrag auf eine Einsicht in Personalakten gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. dd (Personalakten im Archiv) oder eine Auskunft über Personalakten gemäß § 2 Abs. 2 Buchst. b (Personalakte beschuldigte Person/Täter/Täterin) ist die oder der zuständige Verantwortliche.
(2) Die oder der Interventionsbeauftragte des Bistums Trier als zuständige Stelle
• nimmt den Antrag entgegen und bestätigt der den Antrag stellenden Person den Eingang des Antrags innerhalb von 7 Werktagen;
• prüft den Antrag auf Vollständigkeit und ersucht die den Antrag stellende Person gegebenenfalls um Ergänzungen;
• prüft den Antrag eingehend unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen und des berechtigten Interesses der den Antrag stellenden Person. Grundlage der Prüfung sind die Angaben der den Antrag stellenden Person, die Begründung des Antrags und die eingereichten Unterlagen und Nachweise. Bei der Prüfung werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, wie beispielsweise die betreffenden Akten und die Frage, ob der mutmaßliche Täter bzw. die mutmaßliche Täterin verstorben ist (beiderseitige Interessen). Die Entscheidung zur Genehmigung oder Versagung der Akteneinsicht oder Auskunft wird auf Basis dieser Prüfung getroffen;
• holt ggf. die Entscheidung des Bischofs gemäß des ADVG ein.
(3) Ist eine Ablehnung des Antrags vorgesehen, gilt das Vier-Augen-Prinzip. Hierfür wird von der zuständigen Stelle die mit dieser Aufgabe betraute Person aus der Stabsstelle Justiziariat einbezogen. Bei Dissens entscheidet der Bischöfliche Generalvikar.
(4) Der oder die Interventionsbeauftragte des Bistums Trier informiert die den Antrag stellende Person innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrags schriftlich über die Entscheidung. Die Entscheidung muss eine Begründung enthalten. Die Begründung ist so zu formulieren, dass die den Antrag stellende Person die Möglichkeit hat, die Entscheidung zu verstehen (z. B. Vermeidung juristischer und verwaltungstechnischer Fachbegriffe, Nutzung leichter Sprache).
§ 5 Durchführung der Akteneinsicht
(1) Nach Genehmigung des Antrags auf Akteneinsicht vereinbart die oder der Interventionsbeauftragte mit der Einsicht nehmenden Person einen Termin zur Akteneinsicht. Der Termin wird mit der Stabsstelle Justiziariat abgestimmt, damit eine Teilnahme/Begleitung der zuständigen Person aus diesem Bereich an dem Termin der Akteneinsicht gesichert ist.
(2) Der Einsicht nehmenden Person wird der vereinbarte Termin mit Angabe des konkreten Ortes (Gebäude, Raumnummer) und der Uhrzeit unter Beifügung des Leitfadens zur Akteneinsicht/-auskunft i. S. d. § 5 Abs. 9 schriftlich mitgeteilt. Spätestens mit dieser Mitteilung ist die Einsicht nehmende Person darüber zu informieren, dass möglicherweise Teile der Akte durch Unkenntlichmachung anonymisiert sind. Ihr sind die Gründe hierfür mitzuteilen.
(3) Bei der Akteneinsicht darf die Einsicht nehmende Person eine Begleitperson und ggf. einen Rechtsbeistand mitbringen. Der Name der Begleitperson sowie gegebenenfalls ihre Funktion oder Rolle soll rechtzeitig vorher angekündigt werden.
(4) Im Vorfeld der Akteneinsicht sieht eine beauftragte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Person die Akte durch und überprüft sie datenschutzrechtlich. Das bedeutet insbesondere, dass in einer Kopie der Akte, die für die Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird, alle Hinweise unkenntlich gemacht werden, die dritte Personen betreffen oder nicht den Fall, auf den sich der Antrag bezieht. Dies betrifft z. B. Anschreiben oder Vermerke, die verschiedene Fälle und/oder Personen betreffen. Zuständig hierfür ist die oder der Interventionsbeauftragte.
(5) Nach Vorbereitung der Akte erfolgt eine finale Sichtung durch die Stabsstelle Justiziariat.
(6) Am Termin der Akteneinsicht, jedoch vor Einsichtnahme, muss die Einsicht nehmende Person ihre Identität mittels Personalausweises oder eines anderen staatlichen Ausweisdokuments gegenüber der oder dem Interventionsbeauftragten nachweisen. Dies gilt auch für alle Begleitpersonen der Einsicht nehmenden Person.
(7) Die Durchführung des Termins der Akteneinsicht obliegt grundsätzlich der oder dem Interventionsbeauftragten. Sie oder er entscheidet in Absprache mit der Antragstellerin oder dem Antragsteller darüber, ob eine weitere Person über die in Abs. 3 Genannten (z. B. eine psychologische Fachkraft) teilnimmt. Zudem steht eine Person aus der Stabsstelle Justiziariat beratend zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Ablaufs bei der Durchführung der Akteneinsicht und insbesondere des Datenschutzes bereit.
(8) Die Akte darf gelesen, aber nicht verändert werden. Veränderungen sind insbesondere farbliche Markierungen, Streichungen sowie Entwendung oder Zerstörung einzelner Aktenbestandteile. Von den Akten oder Teilen davon darf im Rahmen der Akteneinsicht grundsätzlich keine Aufzeichnung (Kopien, Bild-, Tonaufnahmen, Abschriften etc.) erstellt werden. Auf Antrag der Einsicht nehmenden Person kann das Bistum ausnahmsweise Kopien zur Verfügung stellen, soweit dies – insbesondere nach dem KDG – rechtlich zulässig ist. In dem Fall, dass Kopien zur Verfügung gestellt werden, werden auch die Daten zur beschuldigten Person bzw. zur Person der Täterin/des Täters anonymisiert.
(9) Zu Beginn des Termins der Akteneinsicht wird auf den bereits übermittelten Leitfaden zur Akteneinsicht/-auskunft hingewiesen. Dieser enthält unter anderem folgende Informationen:
• die Akten,
• die Anonymisierung der Unterlagen,
• die nötigen Geräte im Fall der Einsichtnahme in digitalisierte Unterlagen,
• der Ablauf der Akteneinsichtnahme,
• das Verbot, Akten aus dem Raum der Einsichtnahme zu entfernen,
• die Dokumentation der Akteneinsicht,
• darüber, dass grundsätzlich keine Aufzeichnungen (Kopien, Bild-, Tonaufnahmen, Abschriften etc.) erstellt werden dürfen sowie
• die Vertraulichkeitserklärung (Anhänge 1 und 2).
Die Personen, die Einsicht in die Akten nehmen, und ihre Begleitpersonen unterzeichnen vor Durchführung der Akteneinsicht Vertraulichkeitserklärungen, von denen sie eine Ausfertigung erhalten. Sie werden zu den Folgen etwaiger Verstöße nach Absatz 10 belehrt.
(10) Sollte gegen die Hinweise und Regelungen zur Einsichtnahme verstoßen werden, kann die Einsichtnahme sofort beendet werden. Das gleiche gilt im Falle einer vorsätzlichen oder mutwilligen Beschädigung bzw. der Gefahr der Beschädigung von Originaldokumenten. Die Einsicht nehmenden Personen und ihre Begleitpersonen haften gemäß den gesetzlichen Regelungen für Schäden, die sie während der Einsichtnahme verursachen bzw. die diese durch die Weitergabe von Informationen verursachen.
Ein erneuter Antrag auf Einsichtnahme kann in diesen Fällen abgelehnt werden.
(11) Die Akteneinsicht wird standardisiert dokumentiert. Dabei werden insbesondere die an dem Termin teilnehmenden Personen sowie die vorgelegten Akten oder Aktenteile festgehalten.
§ 6 Durchführung der Aktenauskunft
(1) Zuständig für die Erteilung einer Auskunft zu Inhalten
a. von Sachakten im Sinne dieser Ordnung ist die oder der Interventionsbeauftragte;
b. von Personalakten im Falle des § 15 PAO ist der Bereich Personal;
c. von Sach- und Personalakten, die zum Bestand des Bistumsarchivs zählen, die Leitung des Bistumsarchivs.
(2) Die Auskunft wird erteilt durch eine Zusammenfassung des Falles oder eine schriftliche Antwort auf eine konkret gestellte Frage.
(3) Bei der Aktenauskunft sind Rechte unbeteiligter Dritter zu wahren. Daten, die dritte Personen oder nicht den Fall betreffen, zu dem Auskunft beantragt worden ist, sind in der Antwort zu vermeiden oder durch Anonymisierung oder Pseudonymisierung unkenntlich zu machen.
(4) Nach Vorbereitung der Zusammenfassung bzw. der Antwort erfolgt eine finale Sichtung durch die Stabsstelle Justiziariat.
(5) Die erstellte Zusammenfassung bzw. die Antwort auf eine konkrete Anfrage wird der die Auskunft ersuchenden Person schriftlich zugestellt, eine Kopie wird zu den Akten genommen.
(6) Will ein Betroffener sein Recht in Anspruch nehmen, dass die Auskunftserteilung durch eine Notarin oder einen Notar erfolgt, hat sie einen entsprechenden schriftlichen Antrag zu stellen. Der Antrag wird zur Akte genommen. Mit dem Antrag kann die oder der Betroffene eine Notarin oder einen Notar seiner Wahl benennen. Die Beauftragung dieser Person kann das Bistum bei Vorliegen besonderer Gründe verweigern.
Das Bistum beauftragt die Notarin bzw. den Notar, die bzw. der von der betroffenen Person benannt oder vom Bistum ausgewählt wurde, und vereinbart mit ihr bzw. ihm einen Termin. Der Notarin bzw. dem Notar werden die Akten in nicht anonymisierter oder nicht pseudonymisierter Form vorgelegt. Sie bzw. er erstellt die Zusammenfassung für die oder den Betroffenen bzw. beantwortet die gestellten Fragen. Die Anfertigung von Kopien ist nicht zulässig.
Von der Zusammenfassung bzw. dem Antwortschreiben erhalten der Betroffene und das Bistum je eine Ausfertigung.
§ 7 Datenschutz und Vertraulichkeit
(1) Eine Einsichtnahme in die Unterlagen ist nur den berechtigten Personen (vgl. § 2) gestattet.
(2) Um den notwendigen Datenschutz zu beachten, müssen gegebenenfalls Textpassagen, die sich auf andere in den Unterlagen erwähnte Betroffene oder Dritte beziehen, anonymisiert (geschwärzt) werden, um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen.
(3) Bei der Einsichtnahme sind die Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG, KDG – DVO) zu beachten. Des Weiteren können die durch Akteneinsicht oder Auskunft erlangten Informationen allgemeine Persönlichkeitsrechte anderer Personen betreffen. Diese sind grundsätzlich zu wahren.
(4) Ein Auskunftsersuchen einer berechtigten Person wird grundsätzlich schriftlich beantwortet. Kopien der Unterlagen, auf die sich die Auskunft bezieht, werden nicht mitgesendet, soweit dies nicht ausnahmsweise, z. B. zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, notwendig sein sollte.
(5) Die die Beantragung und Durchführung der Auskunft oder Einsicht betreffenden Dokumente werden auch nach der Erledigung für Rückfragen und zum Nachweis der Rechtmäßigkeit aufbewahrt.
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Diese Richtlinien treten am 1. April 2025 in Kraft.
(2) Sie sollen spätestens nach Ablauf des zweiten Jahres ihrer Geltung einer Prüfung unterzogen
werden.
1 Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten für die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für Rechtsanwaltskanzleien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten, Registraturakten und vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung, in: KA 2023 Nr. 93.
2 Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern (Personalaktenordnung), in: KA 2021 Nr. 259.
3 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier mit Anlagen, in: KA 2008 Nr. 38, KA 2011 Nr. 524.
4 Ordnung für Mitarbeitervertretungen im Bistum Trier (Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO), in: KA 2018 Nr. 24, KA 2024 Nr. 64.
5 Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten Dritter in Bezug auf Personalaktendaten von Klerikern, in: KA 2021 Nr. 260.
6 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO), in: KA 2014 Nr. 60, KA 2016 Nr. 227.
7 Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (Interventionsordnung), in: KA 2020 Nr. 2, KA 2022 Nr. 278.
8 Das Antragsformular wird nach Erlass dieser Richtlinie auf der Website des Bistums Trier zur Verfügung gestellt.
9 Sachakten.
10 Weitere Einsichtsrechte: Staat.
11 Dritte höherrangige Interessen.
Trier, den 14. Februar 2025
(Siegel)
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg
Bischöflicher Generalvikar
Quelle:kanzlei.bgv-trier.de