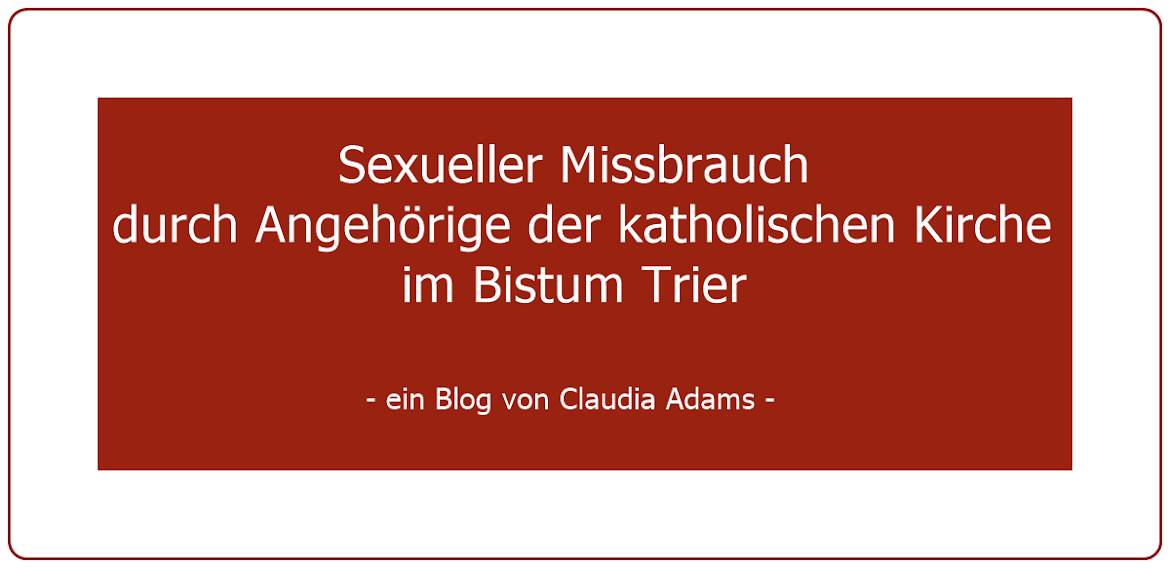Die Bezeichnung „pädokriminelles Netzwerk“ im Bistum Trier
ist angesichts der belegten Muster nicht nur berechtigt, sondern notwendig,
um das Ausmaß institutioneller Verantwortung klar zu benennen.
Im Bistum Trier sind alle Merkmale für ein solches Netzwerk belegt."
Claudia Adams, 28.06.2025
Edit: In der ersten Version dieses Beitrags verwandte ich den Begriff "pädophiles Netzwerk". Doch dies trägt der Tragweite kaum Rechenschaft. "Pädophilie" bezeichnet die sexuelle Neigung eines Erwachsenen zu Kindern, die bei Betroffenen oft zu großem Leid führt – sie ist aber nicht strafbar, solange sie nicht ausgelebt wird. Pädophilie wird erst dann zu Pädokriminalität, sobald ein Kind zum Objekt realer sexueller Handlung, Kommunikation, Darstellung oder Fantasie wird – egal, ob physisch anwesend oder digital. - Da es sich in diesem Kontext um strafbare Handlungen durch kirchliche Angehörige im Bistum Trier handelt und somit die Merkmale eine pädokriminellen Netzwerkes erfüllt sind, werde ich zukünftig auch nur noch den Begriff "pädokriminell" anwenden. (ca) Ein Kommentar
Ein pädokriminelles Netzwerk liegt vor, wenn mehrere Täter über längere Zeit systematisch Kinder missbrauchen und diese Taten durch institutionelle Strukturen ermöglicht, geschützt oder vertuscht werden.
Ein funktionierendes Geflecht aus zahlreichen Tätern mit einem auffallend hohem Anteil an Mehrfach/(Serien-) und Intensivtätern, institutioneller Vertuschung, Schutz durch institutionelle Strukturen und Aufklärungsbehinderung erfüllen die strukturellen Bedingungen eines pädokriminellen Netzwerkes. Genau das ist im Bistum Trier durch Studien, Akten und Medienrecherchen belegt.
Die vorliegenden Daten und dokumentierten Vorgänge belegen nicht nur Einzelfälle von Straftaten sexualisierter Gewalt im Bistum Trier, sondern ein systematisch funktionierendes Geflecht aus Tätern, institutioneller Duldung und struktureller Vertuschung.
Im Bistum Trier sind alle diese Kriterien für die Einordnung eines pädokriminellen Netzwerkes erfüllt.
Warum man im Bistum Trier von einem "pädokriminellen Netzwerk" sprechen kann:
1. Zahlreiche Täter, hoher Wiederholungsanteil
Die quantitativen Daten aus dem Bistum Trier sowie aus bundesweiten Studien zeigen, dass es sich bei Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker nicht um Einzelfälle handelt, sondern um systematische Muster mit hoher Täterdichte und Wiederholungsraten.
Im Bistum Trier wurden laut dem Zweiten Zwischenbericht der Universität Trier zwischen 1981 und 2001 insgesamt 49 Kleriker des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Es konnten mindestens 194 Betroffene identifiziert werden. Besonders auffällig: 14 sogenannte Mehrfach- (Serien-) und Intensivtäter waren für mindestens 148 dieser Fälle verantwortlich – also rund 76 % aller dokumentierten Fälle¹. Diese statistische Konzentration auf eine kleine Gruppe von Tätern mit langjähriger Missbrauchshistorie weist auf ein systemisches Versagen bei Kontrolle und Intervention hin.
2. Institutionelle Vertuschung
Die nicht stattgefundene Strafverfolgung der Täter aus den eigenen Reihen und die ebenso nicht öffentliche Aufklärung durch kirchliche Stellen stellt ein zentrales Element institutioneller Vertuschung dar. Dieses Vorgehen ist sowohl auf Ebene des Bistums Trier als auch bundesweit nachweislich dokumentiert.
Im Bistum Trier hält der Zweite Zwischenbericht der Universität Trier fest, dass in zahlreichen Fällen keine Anzeige erstattet und kein kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet wurde, obwohl Hinweise auf sexualisierte Gewalt vorlagen. Stattdessen wurden beschuldigte Kleriker teilweise mehrfach in andere Pfarreien versetzt, ohne Information der dortigen Verantwortlichen³. Die Forscher kommen zu dem Schluss:
„Die Reaktion des Ordinariats zielte häufig darauf, die Vorwürfe innerhalb der Institution zu regeln und öffentliche wie strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden.“³
Diese Form des internen Umgangs mit schwerwiegenden Vorwürfen dokumentiert ein bewusstes institutionelles Vorgehen, das der Schadensabwehr für die Institution diente – nicht dem Schutz von Betroffenen.
Die Vorgehensweise im Bistum Trier ist Teil eines kirchlichen Gesamtmusters: Institutionelle Mechanismen der Vertuschung, strategische Versetzungen und das bewusste Unterlassen von Aufklärung sind nachweislich Bestandteile einer umfassenden Schutzpraxis zugunsten der Täter. Dieses Verhalten ist – sowohl auf Bistums- als auch Bundesebene – nach Studienlage klar belegt und dokumentiert.
3. Schutz durch institutionelle Strukturen
Die wiederholte Ermöglichung von Missbrauch durch systematische Untätigkeit, gezielte Abschottung von Wissen und das Fehlen externer Kontrolle belegt einen strukturellen Täterschutz. Dieser ergibt sich nicht nur aus individuellen Fehlentscheidungen, sondern aus den organisatorischen Bedingungen kirchlicher Machtverhältnisse.
Im Bistum Trier zeigt sich dies exemplarisch: Die Universität Trier beschreibt, dass beschuldigte Priester nicht isoliert, sondern weiter beschäftigt wurden, häufig ohne disziplinarische Maßnahmen oder Einschränkungen im seelsorglichen Dienst. Die Täter wurden nicht kontrolliert, sondern „in ihren Rechten und Pflichten im kirchlichen Dienst im Wesentlichen belassen“⁵. In mehreren dokumentierten Fällen wurden Priester trotz massiver Hinweise erneut in der Gemeindearbeit eingesetzt und wurden dadurch zum Risiko für potenzielle weitere Opfer⁵.
Diese systemimmanente Schutzfunktion wurde nicht nur von der Trierer Bistumsleitung und dem Ordinariat gestützt, sondern auch durch das kirchenrechtliche Verfahren selbst begünstigt: keine verpflichtende externe Meldepflicht, kein Zugriff externer Kontrollinstanzen und die Entscheidungsgewalt lag vollständig innerhalb der kirchlichen Hierarchie⁵.
Die Gesamtlage im Bistum Trier belegt, dass sexualisierte Gewalt nicht nur durch individuelles Fehlverhalten, sondern durch organisatorisch gestützte Schutzmechanismen begünstigt und gedeckt wurde. Damit ist der Täterschutz nicht als zufälliges oder singuläres Versagen zu werten, sondern als struktureller Bestandteil eines Systems, das der Kirche selbst diente – und den Tätern nützte.
4. Aufklärungsbehinderung
Neben dem passiven Verschweigen und dem strukturellen Schutz von Tätern ist in mehreren dokumentierten Fällen auch von einer aktiven Behinderung von Aufklärung und Ermittlungen auszugehen. Diese betrifft sowohl das Bistum Trier als auch staatliche Stellen, insbesondere im Fall des verstorbenen Priesters Edmund Dillinger:
Laut Medienberichten fanden Ermittler im Nachlass von Edmund Dillinger detaillierte Aufzeichnungen, Fotos und Tagebücher, die auf den sexuellen Missbrauch von vielen Kindern und Jugendlichen hinweisen⁷. Doch es kam zur Vernichtung zentraler möglicher Beweismittel, darunter Terminkalender, Fotos und weiteres Material aus dem Nachlass Dillingers. Die Staatsanwaltschaft ließ mitteilen, die Aktenvernichtung sei „versehentlich“ erfolgt⁷. Zudem kam es nach Dillingers Tod zu einem Einbruch in sein Wohnhaus, bei dem mutmaßlich relevante Unterlagen entwendet wurden⁷. Der "Abschlussbericht" der Ermittler Hromada und Brauer berichtet von mindestens vier namentlich genannten - teils noch lebenden Geistlichen -, die durch Betroffene belastet wurden – jedoch wurden diese Akten den Sonderermittlern nicht zur Verfügung gestellt⁷.
Die "versehentliche" Aktenvernichtung in der Causa Dillinger, die übrigens nach Ankündigung der Studie, aber vor Übergabe stattfand – ist ein schwerwiegender Vorgang, der in der Studie klar benannt wird und das Vertrauen in innerkirchliche Aufarbeitung erheblich erschüttert. Der Generalstaatsanwalt Manfred Kost bat damals für die Vernichtung der Unterlagen um Entschuldigung.
Sowohl im Fall Trier als auch im Rahmen der bundesweiten Aufarbeitung ist belegt, dass die Aufklärung sexualisierter Gewalt nicht nur passiv verschleppt, sondern in mehreren Fällen aktiv behindert wurde – durch Aktenvernichtung, Nichtherausgabe relevanter Unterlagen und die Blockade staatsanwaltlicher Ermittlungen. Dies wurde bereits in der "Pfeiffer-Studie" deutlich und später durch weitere Studien in verschiedenen Bistümern belegt. Diese Form der Aufklärungsbehinderung stellt keine zufällige Panne dar, sondern ist Ausdruck einer institutionellen Risikosteuerung zulasten der Wahrheit und der Betroffenen.
5. Strukturelle Bedingungen eines Netzwerks erfüllt
Ein pädokriminelles Netzwerk im juristischen Sinne setzt nicht zwingend eine konspirative Organisation oder explizite Absprache zwischen Tätern voraus. Auch ein funktional vernetztes System, in dem Täter geschützt, Hinweise ignoriert und Verantwortung weitergereicht wird, kann die Strukturmerkmale eines Netzwerks erfüllen – insbesondere, wenn es über längere Zeiträume Bestand hat und systematisch wirkt.
Die im Zweiten Zwischenbericht der Universität Trier dokumentierten Vorgänge deuten auf ein solches funktionales Netzwerk hin:
- Täter wurden nicht voneinander isoliert, sondern agierten über Jahre parallel innerhalb derselben Institution, teilweise mit gegenseitiger Kenntnis⁹.
- Hinweise auf Missbrauch wurden intern weitergereicht oder ignoriert, nicht an externe Stellen gemeldet.
- Verantwortungsträger handelten nicht individuell, sondern im Rahmen eines strukturell abgesicherten Systems, in dem Missbrauch nicht gestoppt, sondern verwaltet wurde⁹.
- Die Studie konstatiert, dass es sich bei den dokumentierten Fällen nicht um Einzelfälle, sondern um „eine systemische Häufung“ handelt, die nur durch institutionelle Toleranz und Wiederholung erklärbar sei⁹. (Siehe auch "MHG-Studie" und Vergleichsstudie aus den Bistümern Münster und Essen ("IPP-Studie")¹⁰
Die dokumentierten Muster im Bistum Trier – insbesondere der langjährige Schutz bekannter Täter, das gezielte Schweigen institutioneller Akteure und die Wiederholung trotz interner Kenntnis – erfüllen aus struktureller Perspektive die Merkmale eines pädokriminellen Netzwerks: Es handelt sich um ein funktionierendes System des Schweigens, des Schutzes und der Wiederholung, das organisatorisch verankert war und institutionell abgesichert wurde.
Das alles ist kein Zufall. Das ist Struktur. Das ist Netzwerk. Ein pädokriminelles Netzwerk. Gedeckt durch Institution, Macht und Schweigen. Nicht nur im Bistum Trier.
Im Bistum Trier haben nicht nur Täter, sondern auch die Institution selbst an diesem pädokriminellen Netzwerk mitgewirkt.
¹ Universität Trier: Zweiter Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Trier, Juni 2023, S. 18–20.
https://www.uni-trier.de/universitaet/news/beitrag?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25802
² MHG-Studie: „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, Abschlussbericht 2018, S. 7–9, 85.
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-Missbrauch-2018.pdf
³ Universität Trier: Zweiter Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Trier, Juni 2023, S. 18–22.
https://www.uni-trier.de/universitaet/news/beitrag?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25802
⁴ MHG-Studie: Abschlussbericht 2018, S. 85–90.
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-Missbrauch-2018.pdf
⁵ Universität Trier: Zweiter Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Trier, Juni 2023, S. 21–24.
https://www.uni-trier.de/universitaet/news/beitrag?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25802
⁶ MHG-Studie: Abschlussbericht 2018, S. 89–92.
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-Missbrauch-2018.pdf
⁷ Welt.de: „Pater Dillinger soll bis zu 700 Kinder missbraucht haben“, 2023; SR.de, BILD.de: Einbruch, Aktenvernichtung, fehlende Ermittlungszugänge.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article252677332
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/panorama/ermittlungen_dillinger_aktenvernichtung_100.html
⁸ MHG-Studie: Abschlussbericht 2018, S. 14, 85, 90.
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-Missbrauch-2018.pdf
⁹ Universität Trier: Zweiter Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Trier, Juni 2023, S. 22–26.
https://www.uni-trier.de/universitaet/news/beitrag?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25802
¹⁰ MHG-Studie: Abschlussbericht 2018, S. 85–91; siehe auch: ForuM-Studie (2024), IPP-Studie Essen (2023), Studie Bistum Münster (2022).
11. https://www.zeit.de/news/2023-07/14/generalstaatsanwalt-bedauert-vernichtung-von-material
Claudia Adams