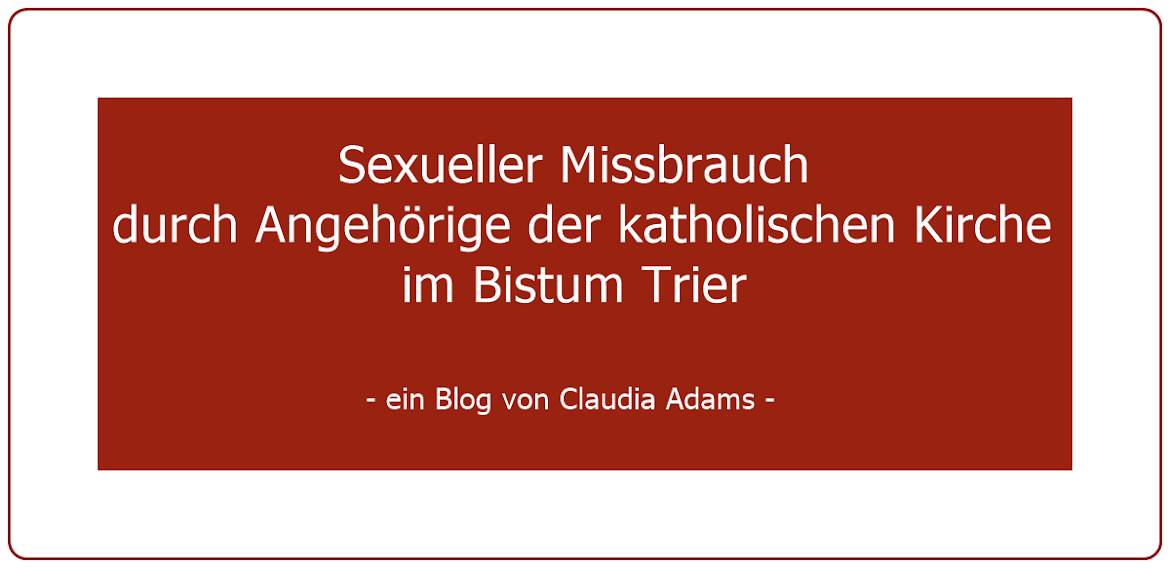Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die kirchenrechtliche Anzeige von Betroffenen sexualisierter Gewalt gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki an den Vatikan weitergegeben. In seiner Funktion als dienstältester Bischof der Metropolie habe er die Anzeige entsprechend der kirchenrechtlichen Vorgaben über die Nuntiatur an das Bischofsdikasterium zur Prüfung weitergeleitet, teilte das Bistum dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch mit. Ackermann habe sowohl den Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz als auch Kardinal Woelki darüber informiert.
- Startseite
- "Causa Edmund Dillinger"
- "Causa Freisen" I, II, III
- "Causa Schönstatt I" - Francisco José Cox
- "Causa Schönstatt II" - Pater Kenntenich
- Fakten, die aus der MHG-Studie hervorgehen
- Grundsätzliches zu den Informationen
- Impressum
- Über mich
- Sexueller Missbrauch durch Angehörige der katholischen Kirche im Bistum Trier - die Chronologie
Donnerstag, 31. Juli 2025
Mittwoch, 30. Juli 2025
UKA-Tätigkeitsbericht 2024: Bistum Trier führt Statistik mit höchsten Fallzahlen an
"Und hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Schrei."
- Claudia Adams -
Am 29. Juli wurde der "Tätigkeitsbericht der Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) 2024" veröffentlicht.
Daraus ergeben sich für das Bistum Trier folgende Fakten:
Mittwoch, 23. Juli 2025
"Wohl kaum aus Überzeugung" - Ein Kommentar von Claudia Adams
Ackermann im Zwiespalt: Ein Bischof zwischen Pflicht und Moral
Bischof Stephan Ackermann befindet sich erneut in einer Situation, die nicht nur seine persönliche Integrität, sondern auch das Vertrauen in die katholische Kirche weiterhin nachhaltig beeinflussen könnte. Ob als ehemaliger Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz oder als Bischof von Trier trägt er eine zentrale Verantwortung bei der Aufarbeitung sexueller Missbrauchsskandale innerhalb der Kirche - und in seinem eigenen Bistum. Doch diese Verantwortung ist in Ackermanns Fall von tiefen Widersprüchen geprägt, die ihn in eine moralischen Zwickmühle führen könnte.
Ausgerechnet Bischof Ackermann entscheidet über die Weiterleitung der Anzeige gegen Woelki nach Rom
Als dienstältester Bischof der Kirchenprovinz Köln, zu der das Bistum Trier gehört, soll Ackermann die Anzeige des Betroffenenbeirats der DBK nun an die zuständige Kurienbehörde mit der Bitte weiterleiten, eine kanonische Voruntersuchung gegen Kardinal Woelki einzuleiten.
Laut dem Kirchenrechtler Thomas Schüller hat der Trierer Bischof bei seiner Entscheidung keine Wahl. „Er muss die Anzeige nach Rom an das Dikasterium für den Glauben und das Dikasterium für die Bischöfe weiterleiten“, sagte Schüller unserer Redaktion. Es sei eine Amtspflicht ohne Ermessensspielraum.
Abonnieren
Kommentare (Atom)