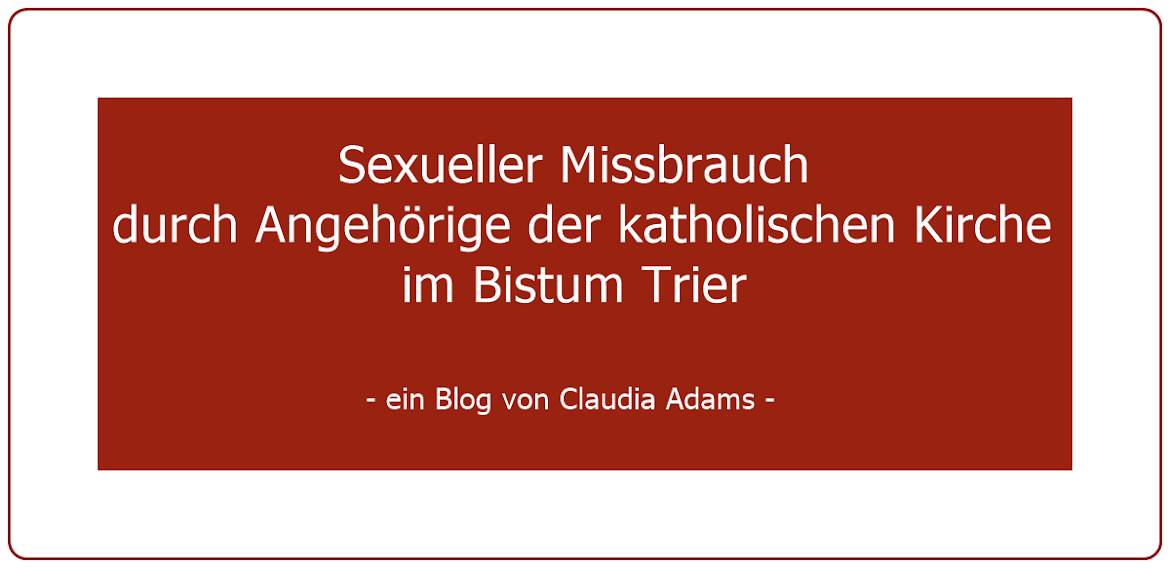(Fotoquelle: Bistum Trier)
Zimmer selbst ist Teil des Systems und vertritt als Präventionsbeauftragter des Bistums Trier genau jene Institution, die systematisch Missbrauch ermöglicht, vertuscht und Täter geschützt hat. Er arbeitet nicht im Auftrag einer neutralen, unabhängigen Stelle, sondern innerhalb des Machtapparates, der Betroffene zutiefst verletzt hat.