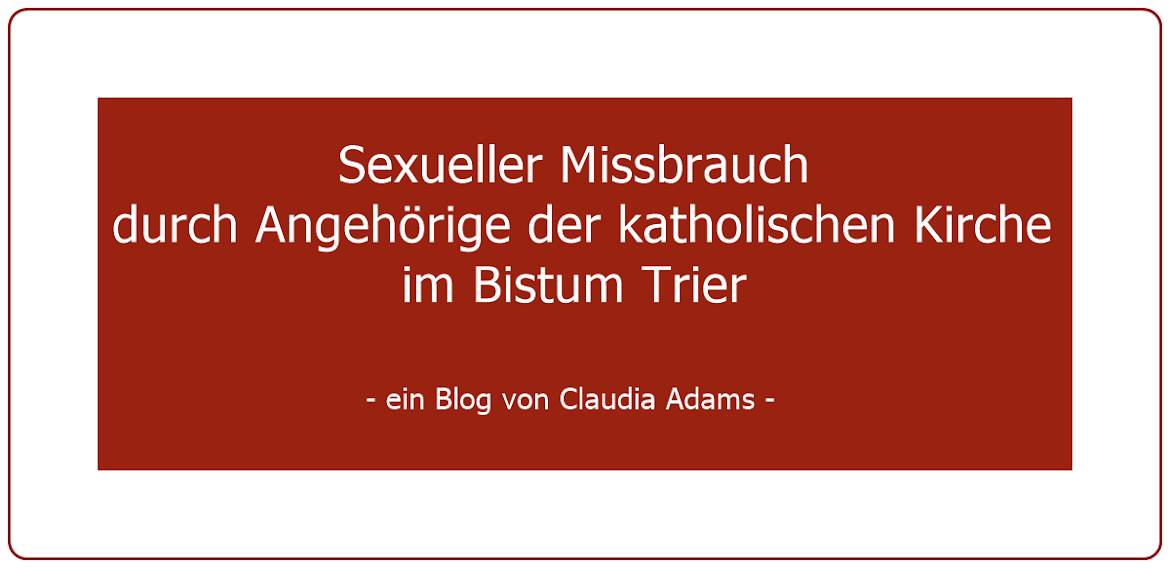Bistum Trier stellt "Leitfaden bei Anliegen zur individuellen Aufarbeitung und Aufklärung von Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum Trier"vor. Direkt zur Broschüre auf der Seite des Bistums Trier.
Wenn der Leitfaden zum Leidfaden wird
Das Bistum Trier eröffnet seinen Leitfaden mit einer Definition von „Aufarbeitung“, die bereits verrät, wohin die Reise geht: in die Relativierung. Statt klar zu benennen, was Aufarbeitung zwingend bedeuten muss – nämlich Verantwortung übernehmen, Strukturen offenlegen, Schuld anerkennen –, versteckt man sich hinter Floskeln: Der Begriff sei „nicht geschützt“ und „nicht einheitlich definiert“. Das ist kein zufälliger Hinweis, sondern ein rhetorisches Manöver: Wer einen Begriff schwammig hält, kann ihn nach Belieben füllen – und gleichzeitig alles abwehren, was unbequem wäre.
Weiter wird unterschieden zwischen individueller und institutioneller Aufarbeitung. Institutionelle Aufarbeitung sei „klar verortet“ bei der Unabhängigen Aufarbeitungskommission – also: ausgelagert. Damit entzieht sich das Bistum der direkten Verantwortung und verweist auf ein Gremium, das zwar unabhängig heißen mag, aber ohne die Kirche nicht existiert.
Die individuelle Aufarbeitung dagegen wird bewusst im Ungefähren gelassen. „Vom Ziel der Betroffenen aus denken“ klingt großherzig, ist aber in Wahrheit ein Papiersatz ohne Substanz. Denn wer definiert letztlich, was möglich ist? Natürlich nicht die Betroffenen selbst, sondern das Bistum – in seinen Verfahren, mit seinen Kriterien, mit seinen Grenzen.
Und wenn es heißt, die Verfahren sollten „knapp und einfach“ beschrieben werden, zeigt sich erneut das Muster: Reduktion auf Verwaltungsschritte. Aufarbeitung wird hier auf Prozesse, Akteneinsichten und Antragswege verkleinert – nicht auf Wahrheitssuche, Gerechtigkeit oder öffentliche Verantwortung.
Ein schönes Versprechen – mit engen Grenzen
Die Verantwortlichen betonen, der Ausgangspunkt müsse das Ziel der Betroffenen sein. Doch die Verfahren, die tatsächlich möglich sind – Akteneinsicht, Anerkennung von Leid, ergänzende Hilfen – bleiben streng innerhalb institutioneller Vorgaben. Ob Akten lückenhaft sind, wie lange ein Verfahren dauert oder welche Unterlagen einsehbar sind: All das bestimmt die Institution, nicht die Betroffenen. Das Versprechen, „vom Ziel der Betroffenen aus“ zu denken, wird so zum Scheinprinzip.
Betroffenenbeirat – eingebunden statt unabhängig
Besonders deutlich wird das beim Betroffenenbeirat. Das Bistum räumt selbst ein, dass ihm „Vorschuss-Misstrauen“ entgegengebracht wird. Doch statt echte Unabhängigkeit zu schaffen, verweist man auf den Beirat – ein Gremium, das direkt an die kirchliche Verwaltung angebunden ist. Betroffene sollen glauben, hier gebe es eine Kontrollinstanz. In Wahrheit bleibt es eine kirchlich kontrollierte Struktur, ohne echte Macht.
Aktenlücken als Zufall dargestellt
Wenn von „lückenhaften Akten“ die Rede ist, klingt das wie ein bedauerlicher Umstand der Vergangenheit. Tatsächlich aber sind diese Lücken das Ergebnis jahrzehntelanger Vertuschung, bewusster Nicht-Dokumentation und systematischer Schonung von Tätern. Wer das verschweigt, lenkt ab vom institutionellen Versagen und tarnt Schuld als bloße „Grenze des Möglichen“.
Keine verbindlichen Fristen – alte Ohnmacht
Besonders schmerzhaft ist die Aussage, man könne keine Bearbeitungszeiten zusagen. Für Betroffene bedeutet das: Wieder Unsicherheit, wieder Abhängigkeit, wieder Machtgefälle. Schon der Missbrauch war geprägt von Kontrollverlust. Dass nun auch die Aufarbeitung keine Verlässlichkeit gibt, wirkt wie eine zweite Entmündigung.
Ein Baukasten voller Hürden
Die Liste der Verfahren klingt nach vielen Optionen: Akteneinsicht, Auskunftsrechte, spirituelle Begleitung, Anerkennungsleistungen, Hilfssysteme, Unfallversicherung, Öffentlichkeit. Doch jedes dieser Verfahren ist an Bedingungen, Formalitäten und Prüfungen gebunden. Was nach Vielfalt aussieht, ist in Wirklichkeit ein Labyrinth, in dem Betroffene sich erneut abmühen müssen – während die Institution jederzeit die Spielregeln vorgibt.
Spirituelle Heilung – ein doppelter Zynismus
Besonders irritierend: Das Bistum bietet „traumasensible Seelsorge“ an, um Betroffenen bei der Aufarbeitung toxischer religiöser Bilder zu helfen. Doch gerade diese religiöse Sprache wurde von Tätern genutzt, um Kinder und Jugendliche zu manipulieren. Wenn dieselbe Institution nun Heilung anbietet, wirkt das wie ein doppeltes Spiel: erst Spiritualität als Waffe, dann Spiritualität als Heilmittel.
Das Ende bestimmt die Institution
Am Schluss erklärt das Bistum, ein Aufarbeitungsprozess könne nur gemeinsam beendet werden. Doch gleichzeitig behält man sich vor, Verfahren „ruhen zu lassen“, wenn „alles ausgeschöpft“ sei. Das bedeutet: Am Ende entscheidet doch wieder die Institution, wann Schluss ist. Betroffene haben keine Garantie, dass ihr Bedürfnis nach Anerkennung, Wahrheit und Gerechtigkeit ernsthaft bis zum Ende verfolgt wird.
Für Betroffene jedoch bleibt das Gefühl, erneut Bittsteller zu sein, während die Kirche darüber entscheidet, wie viel Wahrheit, Anerkennung und Unterstützung sie mir zugesteht. Aufarbeitung wird so zur Verwaltung der Ohnmacht – nicht zu dem, was sie sein müsste: ein klarer, mutiger Schritt in Richtung Verantwortung.