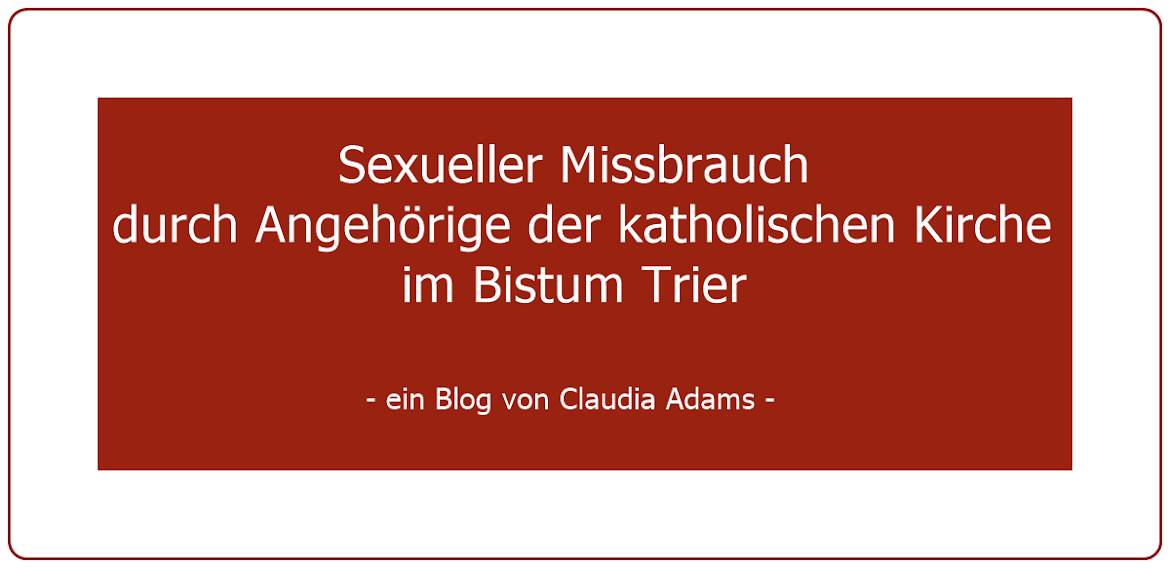Ein heute 64-jähriger Betroffener, der als Schulkind von einen Trierer Bistumspriester über Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht wurde und bis heute unter den Folgen leidet, beabsichtigt, das Bistum Trier auf Schmerzensgeld zu verklagen. Die Summe von 300.000 Euro scheint eine angemessene Entschädigung für das erlittene Leid.
Doch der Betroffene ist auf Prozesskostenhilfe angewiesen und sein Antrag auf diese Hilfe wurde nun auch in zweiter Instanz vor dem Koblenzer Oberlandesgericht abgelehnt. Das Gericht schließt sich der Argumentation der Ersten Instanz, des Trierer Landgerichts, an: Die Taten lägen bereits 50 Jahre zurück und seien verjährt. Zudem habe das Bistum Trier die „Einrede der Verjährung“ erhoben – mit der Begründung, "dass sich aus der Personalakte des beschuldigten Priesters keine Hinweise auf Fehlverhalten" ergäben.
Die Einrede der Verjährung ist ein juristisches Instrument, mit dem ein Anspruch auch dann abgewehrt werden kann, wenn er inhaltlich berechtigt ist – allein, weil eine gesetzliche Frist abgelaufen ist.
Doch es geht um weit mehr als bloße Paragraphen: Es geht um den grundsätzlichen Umgang der Kirche mit den Betroffenen sexuellen Missbrauchs — jenen Kindern und Jugendlichen, die im Bistum Trier von katholischen Priestern schwer missbraucht wurden.
Es geht darum, ob eine Institution, die sich selbst als moralische Instanz versteht, das Unrecht, das ihre Vertreter an Kindern begangen haben, einfach mit einem Verweis auf Fristen abtut. Es geht darum, ob die Kirche bereit ist, Verantwortung zu übernehmen — oder ob sie sich hinter dem juristischen Schutzschild der Verjährung versteckt.
Jahrzehntelang war es bittere Realität: Sexuelle Gewalt an Kindern verjährte oft, bevor die Betroffenen überhaupt das Schweigen brechen konnten. Viele Missbrauchsopfer trugen ihre Geschichte wie eine unsichtbare Last, während ihre Peiniger sich auf juristische Formalien beriefen.
Psychologische und traumaforscherische Erkenntnisse, politische Forderungen nach mehr Opferschutz, die symbolische Verantwortung des Staates, europäische und internationale Einflüsse und nicht zuletzt der gesellschaftliche Druck haben dazu geführt, dass die Verjährungsfristen verlängert wurden – damit endlich mehr Gerechtigkeit für die Opfer möglich wird.
Deshalb wurden die Verjährungsfristen seit 2010 mehrfach reformiert und für besonders schwere Fälle teilweise faktisch aufgehoben. Die Crux: Das Rückwirkungsverbot schützt jedoch weiterhin die Täter, deren Taten bereits nach altem Recht verjährt waren.
Gerade die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche selbst haben aber maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Reformen der Verjährungsfristen überhaupt angestoßen wurden.
Allerdings: Die Katholische Kirche übernimmt seitdem auch eine paradoxe Doppelrolle:
Die Katholische Kirche gehörte nicht nur zu den großen - unfreiwilligen - Problemverursachern (indem sie Missbrauchsfälle systematisch verschwiegen, vertuscht, bagatellisiert und Täter geschützt hat, indem sie diese versetzte statt anzuzeigen, indem sie Akten unvollständig führt, manipulierte und Hinweise auf Taten und Täter vernichtete), nein sie löste durch ihren abertausenden Fällen sexuellen Missbrauchs auch die gesellschaftliche und politische Debatte über Verjährungsfristen maßgeblich mit aus.
Gleichzeitig aber wiederum bezieht sie sich auf die geltenden Verjährungsfristen und stellt sich damit weiter gegen die Betroffenen. Die Kirche hat also die Reform nicht aktiv mitgestaltet oder gefordert, sondern ist auch die Widersacherin und pocht weiterhin vielerorts und weiterhin auf die Einrede der Verjährung, um Entschädigungsansprüche abzuwehren und durch diese Prozesse zu verhindern, dass weitere Straftaten ans Tageslicht kommen.
Ja, die Taten sind nach damaligem Recht verjährt.
Aber es war Bischof Ackermann, der mit seiner Einrede und dieser perfiden Begründung ein Zeichen setzte. Dass er sich gegen die verlängerten Verjährungsfristen stellt und gegen all jene, die für mehr Gerechtigkeit gekämpft haben. Damit stellt er das jahrzehntelange Ringen der Betroffenen in den Hintergrund und schützt damit de facto die Täter vor den berechtigten Ansprüchen der Opfer.
Doch damit nicht genug: Ackermann rechtfertigen die Einrede der Verjährung damit, dass „aus der Personalakte des beschuldigten Priesters keine Hinweise auf Fehlverhalten“ hervorgingen.
Diese Argumentation ist allerdings eine inakzeptable Verkürzung der Tatsachen. Die bloße Behauptung, „es gebe keine Hinweise auf Fehlverhalten in der Akte“, kann und darf nicht ausreichen, um einem Opfer von schwerem sexuellem Missbrauch die Chance auf Aufarbeitung und Entschädigung zu verweigern.
Ackermann stützt sich hier auf eine Aktenführung, die nachweislich unvollständig, manipuliert oder bewusst irreführend geführt wurde. Unabhängige Gutachten haben wiederholt belegt, dass genau in diesen Personalakten Hinweise verschleiert, bagatellisiert oder gar nicht erst aufgenommen wurden. - Wie objektiv und umfassend kann überhaupt unter diesen Bedingungen noch Aufklärung stattfinden?
Der Trierer Bischof macht sich durch diese Aktion selbst zum Richter über die eigene Verantwortung – das ist weder mit dem Anspruch auf Gerechtigkeit noch mit moralischem Verantwortungsbewusstsein vereinbar.
Die Verantwortung des Bistums Trier gegenüber Betroffenen wird somit weiterhin konterkariert und pervertiert.
Denn den Betroffenen wird eine doppelte Last auferlegt: Zuerst müssen sie das erlittene Unrecht ertragen, anschließend sollen sie auch noch beweisen, was durch eine lückenhafte Aktenführung verschleiert wurde. - Ein fundamentaler Verstoß gegen die Prinzipien von Rechtsstaat und Moral.
Als Bischof – und besonders in seiner Funktion als ehemaliger „Missbrauchsbeauftragter“ (und ja, Ackermann scheint tatsächlich mehr Missbrauchsbeauftragter gewesen zu sein als "Antimissbrauchsbeauftragter") - wäre es seine Pflicht gewesen, alles dafür zu tun, die institutionellen Versäumnisse aufzuarbeiten und den Betroffenen Gerechtigkeit zu verschaffen. Dazu hätte eine unabhängige und umfassende Aufklärung sowie die ernsthafte Bereitschaft zu materieller und ideeller Wiedergutmachung gehört.
Dass Ackermann sich für die Einrede der Verjährung entschied und diese ausgerechnet mit den Worten begründete, dass sich aus der Personalakte des beschuldigten Priesters keine Hinweise auf Fehlverhalten ergäben, ist daher an Hohn kaum zu überbieten.
Damit dokumentiert Ackermann eindrucksvoll, auf wessen Seite er immer noch steht.